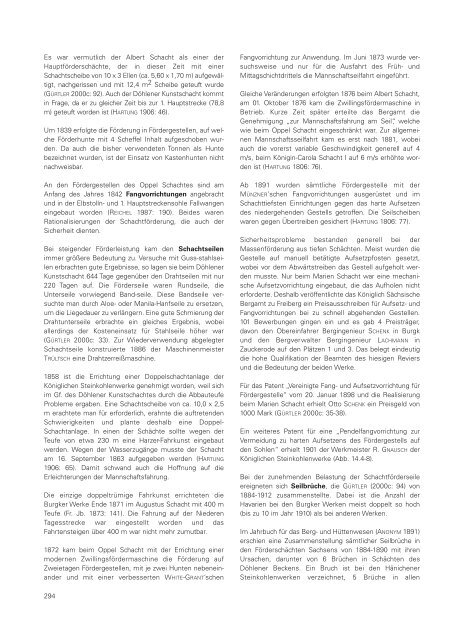Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Es war vermutlich der Albert Schacht als einer der<br />
Hauptförderschächte, der in dieser Zeit mit einer<br />
Schachtscheibe von 10 x 3 Ellen (ca. 5,60 x 1,70 m) aufgewältigt,<br />
nachgerissen und mit 12,4 m 2 Scheibe geteuft wurde<br />
(GÜRTLER 2000c: 92). Auch der <strong>Döhlener</strong> Kunstschacht kommt<br />
in Frage, da er zu gleicher Zeit bis zur 1. Hauptstrecke (78,8<br />
m) geteuft worden ist (HARTUNG 1906: 46).<br />
Um 1839 erfolgte die Förderung in Fördergestellen, auf welche<br />
Förderhunte mit 4 Scheffel Inhalt aufgeschoben wurden.<br />
Da auch die bisher verwendeten Tonnen als Hunte<br />
bezeichnet wurden, ist der Einsatz von Kastenhunten nicht<br />
nachweisbar.<br />
An den Fördergestellen des Oppel Schachtes sind am<br />
Anfang des Jahres 1842 Fangvorrichtungen angebracht<br />
und in der Elbstolln- und 1. Hauptstreckensohle Fallwangen<br />
eingebaut worden (REICHEL 1987: 190). Beides waren<br />
Rationalisierungen der Schachtförderung, die auch der<br />
Sicherheit dienten.<br />
Bei steigender Förderleistung kam den Schachtseilen<br />
immer größere Bedeutung zu. Versuche mit Guss-stahlseilen<br />
erbrachten gute Ergebnisse, so lagen sie <strong>bei</strong>m <strong>Döhlener</strong><br />
Kunstschacht 644 Tage gegenüber den Drahtseilen mit nur<br />
220 Tagen auf. Die Förderseile waren Rundseile, die<br />
Unterseile vorwiegend Band-seile. Diese Bandseile versuchte<br />
man durch Aloe- oder Manila-Hanfseile zu ersetzen,<br />
um die Liegedauer zu verlängern. Eine gute Schmierung der<br />
Drahtunterseile erbrachte ein gleiches Ergebnis, wo<strong>bei</strong><br />
allerdings der Kosteneinsatz für Stahlseile höher war<br />
(GÜRTLER 2000c: 33). Zur Wiederverwendung abgelegter<br />
Schachtseile konstruierte 1886 der Maschinenmeister<br />
TRÜLTSCH eine Drahtzerreißmaschine.<br />
1858 ist die Errichtung einer Doppelschachtanlage der<br />
Königlichen Steinkohlenwerke genehmigt worden, weil sich<br />
im Gf. des <strong>Döhlener</strong> Kunstschachtes durch die Abbauteufe<br />
Probleme ergaben. Eine Schachtscheibe von ca. 10,0 x 2,5<br />
m erachtete man für erforderlich, erahnte die auftretenden<br />
Schwierigkeiten und plante deshalb eine Doppel-<br />
Schachtanlage. In einen der Schächte sollte wegen der<br />
Teufe von etwa 230 m eine Harzer-Fahrkunst eingebaut<br />
werden. Wegen der Wasserzugänge musste der Schacht<br />
am 16. September 1863 aufgegeben werden (HARTUNG<br />
1906: 65). Damit schwand auch die Hoffnung auf die<br />
Erleichterungen der Mannschaftsfahrung.<br />
Die einzige doppeltrümige Fahrkunst errichteten die<br />
Burgker Werke Ende 1871 im Augustus Schacht mit 400 m<br />
Teufe (Fr. Jb. 1873: 141). Die Fahrung auf der Niederen<br />
Tagesstrecke war eingestellt worden und das<br />
Fahrtensteigen über 400 m war nicht mehr zumutbar.<br />
1872 kam <strong>bei</strong>m Oppel Schacht mit der Errichtung einer<br />
modernen Zwillingsfördermaschine die Förderung auf<br />
Zweietagen Fördergestellen, mit je zwei Hunten nebeneinander<br />
und mit einer verbesserten WHITE-GRANT’schen<br />
294<br />
Fangvorrichtung zur Anwendung. Im Juni 1873 wurde versuchsweise<br />
und nur für die Ausfahrt des Früh- und<br />
Mittagschichtdrittels die Mannschaftseilfahrt eingeführt.<br />
Gleiche Veränderungen erfolgten 1876 <strong>bei</strong>m Albert Schacht,<br />
am 01. Oktober 1876 kam die Zwillingsfördermaschine in<br />
Betrieb. Kurze Zeit später erteilte das Bergamt die<br />
Genehmigung „zur Mannschaftsfahrung am Seil“, welche<br />
wie <strong>bei</strong>m Oppel Schacht eingeschränkt war. Zur allgemeinen<br />
Mannschaftsseilfahrt kam es erst nach 1881, wo<strong>bei</strong><br />
auch die vorerst variable Geschwindigkeit generell auf 4<br />
m/s, <strong>bei</strong>m Königin-Carola Schacht I auf 6 m/s erhöhte worden<br />
ist (HARTUNG 1806: 76).<br />
Ab 1891 wurden sämtliche Fördergestelle mit der<br />
MÜNZNER’schen Fangvorrichtungen ausgerüstet und im<br />
Schachttiefsten Einrichtungen gegen das harte Aufsetzen<br />
des niedergehenden Gestells getroffen. Die Seilscheiben<br />
waren gegen Übertreiben gesichert (HARTUNG 1806: 77).<br />
Sicherheitsprobleme bestanden generell <strong>bei</strong> der<br />
Massenförderung aus tiefen Schächten. Meist wurden die<br />
Gestelle auf manuell betätigte Aufsetzpfosten gesetzt,<br />
wo<strong>bei</strong> vor dem Abwärtstreiben das Gestell aufgeholt werden<br />
musste. Nur <strong>bei</strong>m Marien Schacht war eine mechanische<br />
Aufsetzvorrichtung eingebaut, die das Aufholen nicht<br />
erforderte. Deshalb veröffentlichte das Königlich Sächsische<br />
Bergamt zu Freiberg ein Preisausschreiben für Aufsetz- und<br />
Fangvorrichtungen <strong>bei</strong> zu schnell abgehenden Gestellen.<br />
101 Bewerbungen gingen ein und es gab 4 Preisträger,<br />
davon den Obereinfahrer Bergingenieur SCHENK in Burgk<br />
und den Bergverwalter Bergingenieur LACHMANN in<br />
Zauckerode auf den Plätzen 1 und 3. <strong>Das</strong> belegt eindeutig<br />
die hohe Qualifikation der Beamten des hiesigen Reviers<br />
und die Bedeutung der <strong>bei</strong>den Werke.<br />
Für das Patent „Vereinigte Fang- und Aufsetzvorrichtung für<br />
Fördergestelle“ vom 20. Januar 1898 und die Realisierung<br />
<strong>bei</strong>m Marien Schacht erhielt Otto SCHENK ein Preisgeld von<br />
1000 Mark (GÜRTLER 2000c: 35-38).<br />
Ein weiteres Patent für eine „Pendelfangvorrichtung zur<br />
Vermeidung zu harten Aufsetzens des Fördergestells auf<br />
den Sohlen“ erhielt 1901 der Werkmeister R. GNAUSCH der<br />
Königlichen Steinkohlenwerke (Abb. 14.4-8).<br />
Bei der zunehmenden Belastung der Schachtförderseile<br />
ereigneten sich Seilbrüche, die GÜRTLER (2000c: 94) von<br />
1884-1912 zusammenstellte. Da<strong>bei</strong> ist die Anzahl der<br />
Havarien <strong>bei</strong> den Burgker Werken meist doppelt so hoch<br />
(bis zu 10 im Jahr 1910) als <strong>bei</strong> anderen Werken.<br />
Im Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen (ANONYM 1891)<br />
erschien eine Zusammenstellung sämtlicher Seilbrüche in<br />
den Förderschächten Sachsens von 1884-1890 mit ihren<br />
Ursachen, darunter von 6 Brüchen in Schächten des<br />
<strong>Döhlener</strong> <strong>Becken</strong>s. Ein Bruch ist <strong>bei</strong> den Hänichener<br />
Steinkohlenwerken verzeichnet, 5 Brüche in allen