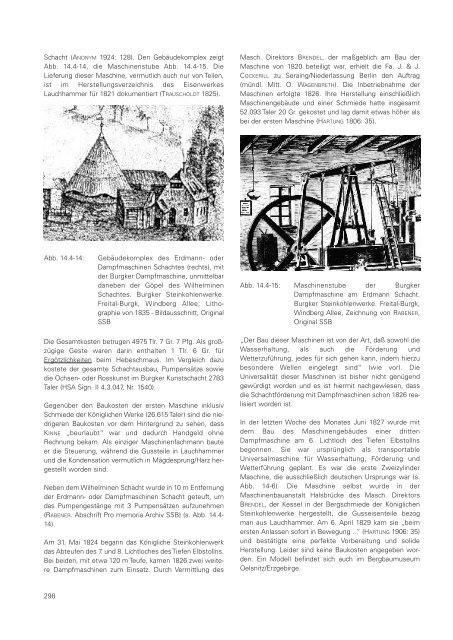Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schacht (ANONYM 1924: 128). Den Gebäudekomplex zeigt<br />
Abb. 14.4-14, die Maschinenstube Abb. 14.4-15. Die<br />
Lieferung dieser Maschine, vermutlich auch nur von Teilen,<br />
ist im Herstellungsverzeichnis des Eisenwerkes<br />
Lauchhammer für 1821 dokumentiert (TRAUSCHOLDT 1825).<br />
Abb. 14.4-14: Gebäudekomplex des Erdmann- oder<br />
Dampfmaschinen Schachtes (rechts), mit<br />
der Burgker Dampfmaschine, unmittelbar<br />
daneben der Göpel des Wilhelminen<br />
Schachtes. Burgker Steinkohlenwerke.<br />
Freital-Burgk, Windberg Allee; Lithographie<br />
von 1835 - Bildausschnitt, Original<br />
SSB<br />
Die Gesamtkosten betrugen 4975 Tlr. 7 Gr. 7 Pfg. Als großzügige<br />
Geste waren darin enthalten 1 Tlr. 6 Gr. für<br />
Ergötzlichkeiten <strong>bei</strong>m Hebeschmaus. Im Vergleich dazu<br />
kostete der gesamte Schachtausbau, Pumpensätze sowie<br />
die Ochsen- oder Rosskunst im Burgker Kunstschacht 2783<br />
Taler (HSA Sign. II 4.3.047, Nr. 1540).<br />
Gegenüber den Baukosten der ersten Maschine inklusiv<br />
Schmiede der Königlichen Werke (26.615 Taler) sind die niedrigeren<br />
Baukosten vor dem Hintergrund zu sehen, dass<br />
KINNE „beurlaubt“ war und dadurch Handgeld ohne<br />
Rechnung bekam. Als einziger Maschinenfachmann baute<br />
er die Steuerung, während die Gussteile in Lauchhammer<br />
und die Kondensation vermutlich in Mägdesprung/Harz hergestellt<br />
worden sind.<br />
Neben dem Wilhelminen Schacht wurde in 10 m Entfernung<br />
der Erdmann- oder Dampfmaschinen Schacht geteuft, um<br />
das Pumpengestänge mit 3 Pumpensätzen aufzunehmen<br />
(RABENER. Abschrift Pro memoria Archiv SSB) (s. Abb. 14.4-<br />
14).<br />
Am 31. Mai 1824 begann das Königliche Steinkohlenwerk<br />
das Abteufen des 7. und 8. Lichtloches des Tiefen Elbstollns.<br />
Bei <strong>bei</strong>den, mit etwa 120 m Teufe, kamen 1826 zwei weitere<br />
Dampfmaschinen zum Einsatz. Durch Vermittlung des<br />
298<br />
Masch. Direktors BRENDEL, der maßgeblich am Bau der<br />
Maschine von 1820 beteiligt war, erhielt die Fa. J. & J.<br />
COCKERILL zu Seraing/Niederlassung Berlin den Auftrag<br />
(mündl. Mitt. O. WAGENBRETH). Die Inbetriebnahme der<br />
Maschinen erfolgte 1826. Ihre Herstellung einschließlich<br />
Maschinengebäude und einer Schmiede hatte insgesamt<br />
52.093 Taler 20 Gr. gekostet und lag damit etwas höher als<br />
<strong>bei</strong> der ersten Maschine (HARTUNG 1806: 35).<br />
Abb. 14.4-15: Maschinenstube der Burgker<br />
Dampfmaschine am Erdmann Schacht.<br />
Burgker Steinkohlenwerke. Freital-Burgk,<br />
Windberg Allee, Zeichnung von RABENER,<br />
Original SSB<br />
„Der Bau dieser Maschinen ist von der Art, daß sowohl die<br />
Wasserhaltung, als auch die Förderung und<br />
Wetterzuführung, jedes für sich gehen kann, indem hierzu<br />
besondere Wellen eingelegt sind“ (wie vor). Die<br />
Universalität dieser Maschinen ist bisher nicht genügend<br />
gewürdigt worden und es ist hiermit nachgewiesen, dass<br />
die Schachtförderung mit Dampfmaschinen schon 1826 realisiert<br />
worden ist.<br />
In der letzten Woche des Monates Juni 1827 wurde mit<br />
dem Bau des Maschinengebäudes einer dritten<br />
Dampfmaschine am 6. Lichtloch des Tiefen Elbstollns<br />
begonnen. Sie war ursprünglich als transportable<br />
Universalmaschine für Wasserhaltung, Förderung und<br />
Wetterführung geplant. Es war die erste Zweizylinder<br />
Maschine, die ausschließlich deutschen Ursprungs war (s.<br />
Abb. 14-6). Die Maschine selbst wurde in der<br />
Maschinenbauanstalt Halsbrücke des Masch. Direktors<br />
BRENDEL, der Kessel in der Bergschmiede der Königlichen<br />
Steinkohlenwerke hergestellt, die Gusseisenteile bezog<br />
man aus Lauchhammer. Am 6. April 1829 kam sie „<strong>bei</strong>m<br />
ersten Anlassen sofort in Bewegung ...“ (HARTUNG 1906: 35)<br />
und bestätigte eine perfekte Vorbereitung und solide<br />
Herstellung. Leider sind keine Baukosten angegeben worden.<br />
Ein Modell befindet sich auch im <strong>Bergbau</strong>museum<br />
Oelsnitz/Erzgebirge.