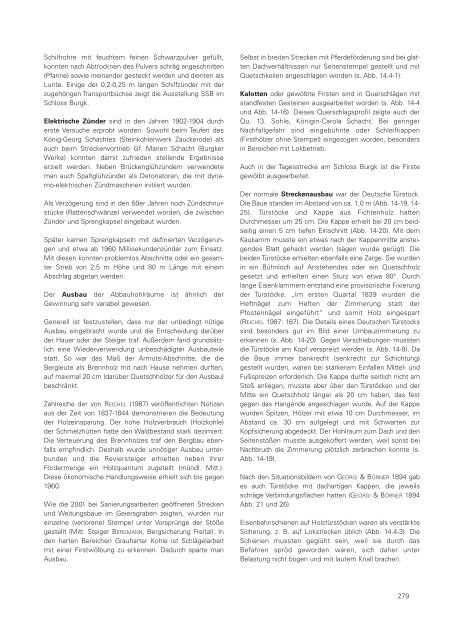Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Schilfrohre mit feuchtem feinen Schwarzpulver gefüllt,<br />
konnten nach Abtrocknen des Pulvers schräg angeschnitten<br />
(Pfanne) sowie ineinander gesteckt werden und dienten als<br />
Lunte. Einige der 0,2-0,25 m langen Schilfzünder mit der<br />
zugehörigen Transportbüchse zeigt die Ausstellung SSB im<br />
Schloss Burgk.<br />
Elektrische Zünder sind in den Jahren 1902-1904 durch<br />
erste Versuche erprobt worden. Sowohl <strong>bei</strong>m Teufen des<br />
König-Georg Schachtes (Steinkohlenwerk Zauckerode) als<br />
auch <strong>bei</strong>m Streckenvortrieb Gf. Marien Schacht (Burgker<br />
Werke) konnten damit zufrieden stellende Ergebnisse<br />
erzielt werden. Neben Brückenglühzündern verwendete<br />
man auch Spaltglühzünder als Detonatoren, die mit dynamo-elektrischen<br />
Zündmaschinen initiiert wurden.<br />
Als Verzögerung sind in den 50er Jahren noch Zündschnurstücke<br />
(Rattenschwänze) verwendet worden, die zwischen<br />
Zünder und Sprengkapsel eingebaut wurden.<br />
Später kamen Sprengkapseln mit definierten Verzögerungen<br />
und etwa ab 1960 Millisekundenzünder zum Einsatz.<br />
Mit diesen konnten problemlos Abschnitte oder ein gesamter<br />
Streb von 2,5 m Höhe und 80 m Länge mit einem<br />
Abschlag abgetan werden.<br />
Der Ausbau der Abbauhohlräume ist ähnlich der<br />
Gewinnung sehr variabel gewesen.<br />
Generell ist festzustellen, dass nur der unbedingt nötige<br />
Ausbau eingebracht wurde und die Entscheidung darüber<br />
der Hauer oder der Steiger traf. Außerdem fand grundsätzlich<br />
eine Wiederverwendung unbeschädigter Ausbauteile<br />
statt. So war das Maß der Armuts-Abschnitte, die die<br />
Bergleute als Brennholz mit nach Hause nehmen durften,<br />
auf maximal 20 cm (darüber Quetschhölzer für den Ausbau)<br />
beschränkt.<br />
Zahlreiche der von REICHEL (1987) veröffentlichten Notizen<br />
aus der Zeit von 1837-1844 demonstrieren die Bedeutung<br />
der Holzeinsparung. Der hohe Holzverbrauch (Holzkohle)<br />
der Schmelzhütten hatte den Waldbestand stark dezimiert.<br />
Die Verteuerung des Brennholzes traf den <strong>Bergbau</strong> ebenfalls<br />
empfindlich. Deshalb wurde unnötiger Ausbau unterbunden<br />
und die Reviersteiger erhielten neben ihrer<br />
Fördermenge ein Holzquantum zugeteilt (mündl. Mitt.).<br />
Diese ökonomische Handlungsweise erhielt sich bis gegen<br />
1960.<br />
Wie die 2001 <strong>bei</strong> Sanierungsar<strong>bei</strong>ten geöffneten Strecken<br />
und Weitungsbaue im Geiersgraben zeigten, wurden nur<br />
einzelne (verlorene) Stempel unter Vorsprünge der Stöße<br />
gestellt (Mitt. Steiger BERGMANN, Bergsicherung Freital). In<br />
den harten Bereichen Grauharter Kohle ist Schlägelar<strong>bei</strong>t<br />
mit einer Firstwölbung zu erkennen. Dadurch sparte man<br />
Ausbau.<br />
Selbst in breiten Strecken mit Pferdeförderung sind <strong>bei</strong> glatten<br />
Dachverhältnissen nur Seitenstempel gestellt und mit<br />
Quetschkeilen angeschlagen worden (s. Abb. 14.4-1).<br />
Kalotten oder gewölbte Firsten sind in Querschlägen mit<br />
standfesten Gesteinen ausgear<strong>bei</strong>tet worden (s. Abb. 14-4<br />
und Abb. 14-16). Dieses Querschlagsprofil zeigte auch der<br />
Qu. 13. Sohle, Königin-Carola Schacht. Bei geringer<br />
Nachfallgefahr sind eingebühnte oder Schleifkappen<br />
(Firsthölzer ohne Stempel) eingezogen worden, besonders<br />
in Bereichen mit Lokbetrieb.<br />
Auch in der Tagesstrecke am Schloss Burgk ist die Firste<br />
gewölbt ausgear<strong>bei</strong>tet.<br />
Der normale Streckenausbau war der Deutsche Türstock.<br />
Die Baue standen im Abstand von ca. 1,0 m (Abb. 14-19, 14-<br />
25). Türstöcke und Kappe aus Fichtenholz hatten<br />
Durchmesser um 25 cm. Die Kappe erhielt <strong>bei</strong> 20 cm <strong>bei</strong>dseitig<br />
einen 5 cm tiefen Einschnitt (Abb. 14-20). Mit dem<br />
Kaukamm musste ein etwas nach der Kappenmitte ansteigendes<br />
Blatt gehackt werden (sägen wurde gerügt). Die<br />
<strong>bei</strong>den Türstöcke erhielten ebenfalls eine Zarge. Sie wurden<br />
in ein Bühnloch auf Anstehendes oder ein Quetschholz<br />
gesetzt und erhielten einen Sturz von etwa 80°. Durch<br />
lange Eisenklammern entstand eine provisorische Fixierung<br />
der Türstöcke. „Im ersten Quartal 1839 wurden die<br />
Heftnägel zum Heften der Zimmerung statt der<br />
Pfostennägel eingeführt“ und somit Holz eingespart<br />
(REICHEL 1987: 187). Die Details eines Deutschen Türstocks<br />
sind besonders gut im Bild einer Umbauzimmerung zu<br />
erkennen (s. Abb. 14-20). Gegen Verschiebungen mussten<br />
die Türstöcke am Kopf verspreizt werden (s. Abb. 14-9). Da<br />
die Baue immer bankrecht (senkrecht zur Schichtung)<br />
gestellt wurden, waren <strong>bei</strong> stärkerem Einfallen Mittel- und<br />
Fußspreizen erforderlich. Die Kappe durfte seitlich nicht am<br />
Stoß anliegen, musste aber über den Türstöcken und der<br />
Mitte ein Quetschholz länger als 20 cm haben, das fest<br />
gegen das Hangende angeschlagen wurde. Auf der Kappe<br />
wurden Spitzen, Hölzer mit etwa 10 cm Durchmesser, im<br />
Abstand ca. 30 cm aufgelegt und mit Schwarten zur<br />
Kopfsicherung abgedeckt. Der Hohlraum zum Dach und den<br />
Seitenstößen musste ausgekoffert werden, weil sonst <strong>bei</strong><br />
Nachbruch die Zimmerung plötzlich zerbrechen konnte (s.<br />
Abb. 14-19).<br />
Nach den Situationsbildern von GEORGI & BÖRNER 1894 gab<br />
es auch Türstöcke mit dachartigen Kappen, die jeweils<br />
schräge Verbindungsflächen hatten (GEORGI & BÖRNER 1894<br />
Abb. 21 und 26).<br />
Eisenbahnschienen auf Holztürstöcken waren als verstärkte<br />
Sicherung, z. B. auf Lokstrecken üblich (Abb. 14.4-3). Die<br />
Schienen mussten geglüht sein, weil sie durch das<br />
Befahren spröd geworden waren, sich daher unter<br />
Belastung nicht bogen und mit lautem Knall brachen.<br />
279