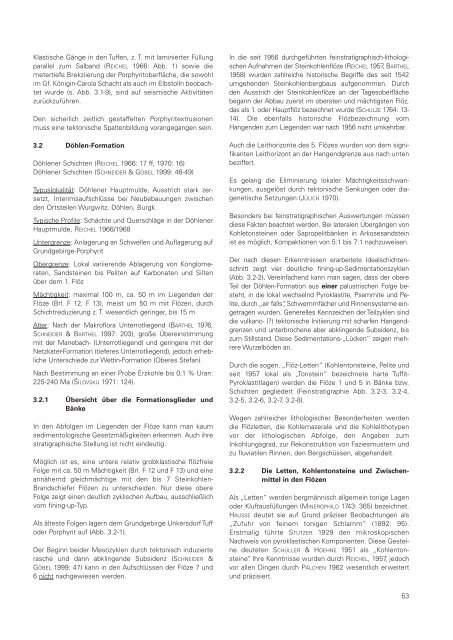Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Klastische Gänge in den Tuffen, z. T. mit laminierter Füllung<br />
parallel zum Salband (REICHEL 1966: Abb. 1) sowie die<br />
metertiefe Brekziierung der Porphyritoberfläche, die sowohl<br />
im Gf. Königin-Carola Schacht als auch im Elbstolln beobachtet<br />
wurde (s. Abb. 3.1-9), sind auf seismische Aktivitäten<br />
zurückzuführen.<br />
Den sicherlich zeitlich gestaffelten Porphyritextrusionen<br />
muss eine tektonische Spaltenbildung vorangegangen sein.<br />
3.2 Döhlen-Formation<br />
<strong>Döhlener</strong> Schichten (REICHEL 1966: 17 ff, 1970: 16)<br />
<strong>Döhlener</strong> Schichten (SCHNEIDER & GÖBEL 1999: 46-49)<br />
Typuslokalität: <strong>Döhlener</strong> Hauptmulde, Ausstrich stark zersetzt,<br />
Interimsaufschlüsse <strong>bei</strong> Neubebauungen zwischen<br />
den Ortsteilen Wurgwitz, Döhlen, Burgk.<br />
Typische Profile: Schächte und Querschläge in der <strong>Döhlener</strong><br />
Hauptmulde, REICHEL 1966/1968<br />
Untergrenze: Anlagerung an Schwellen und Auflagerung auf<br />
Grundgebirge-Porphyrit<br />
Obergrenze: Lokal variierende Ablagerung von Konglomeraten,<br />
Sandsteinen bis Peliten auf Karbonaten und Silten<br />
über dem 1. Flöz<br />
Mächtigkeit: maximal 100 m, ca. 50 m im Liegenden der<br />
Flöze (Brl. F 12, F 13), meist um 50 m mit Flözen, durch<br />
Schichtreduzierung z. T. wesentlich geringer, bis 15 m<br />
Alter: Nach der Makroflora Unterrotliegend (BARTHEL 1976,<br />
SCHNEIDER & BARTHEL 1997: 203), große Übereinstimmung<br />
mit der Manebach- (Unterrotliegend) und geringere mit der<br />
Netzkater-Formation (tieferes Unterrotliegend), jedoch erhebliche<br />
Unterschiede zur Wettin-Formation (Oberes Stefan).<br />
Nach Bestimmung an einer Probe Erzkohle bis 0,1 % Uran:<br />
225-240 Ma (ŠILOVSKIJ 1971: 124).<br />
3.2.1 Übersicht über die Formationsglieder und<br />
Bänke<br />
In den Abfolgen im Liegenden der Flöze kann man kaum<br />
sedimentologische Gesetzmäßigkeiten erkennen. Auch ihre<br />
stratigraphische Stellung ist nicht eindeutig.<br />
Möglich ist es, eine untere relativ grobklastische flözfreie<br />
Folge mit ca. 50 m Mächtigkeit (Brl. F 12 und F 13) und eine<br />
annähernd gleichmächtige mit den bis 7 Steinkohlen-<br />
Brandschiefer Flözen zu unterscheiden. Nur diese obere<br />
Folge zeigt einen deutlich zyklischen Aufbau, ausschließlich<br />
vom fining-up-Typ.<br />
Als älteste Folgen lagern dem Grundgebirge Unkersdorf Tuff<br />
oder Porphyrit auf (Abb. 3.2-1).<br />
Der Beginn <strong>bei</strong>der Mesozyklen durch tektonisch induzierte<br />
rasche und dann abklingende Subsidenz (SCHNEIDER &<br />
GÖBEL 1999: 47) kann in den Aufschlüssen der Flöze 7 und<br />
6 nicht nachgewiesen werden.<br />
In die seit 1956 durchgeführten feinstratigraphisch-lithologischen<br />
Aufnahmen der Steinkohlenflöze (REICHEL 1957, BARTHEL<br />
1958) wurden zahlreiche historische Begriffe des seit 1542<br />
umgehenden Steinkohlenbergbaus aufgenommen. Durch<br />
den Ausstrich der Steinkohlenflöze an der Tagesoberfläche<br />
begann der Abbau zuerst im obersten und mächtigsten Flöz,<br />
das als 1. oder Hauptflöz bezeichnet wurde (SCHULZE 1764: 13-<br />
14). Die ebenfalls historische Flözbezeichnung vom<br />
Hangenden zum Liegenden war nach 1956 nicht umkehrbar.<br />
Auch die Leithorizonte des 5. Flözes wurden von dem signifikanten<br />
Leithorizont an der Hangendgrenze aus nach unten<br />
beziffert.<br />
Es gelang die Eliminierung lokaler Mächtigkeitsschwankungen,<br />
ausgelöst durch tektonische Senkungen oder diagenetische<br />
Setzungen (JÜLICH 1970).<br />
Besonders <strong>bei</strong> feinstratigraphischen Auswertungen müssen<br />
diese Fakten beachtet werden. Bei lateralen Übergängen von<br />
Kohletonsteinen oder Sapropelitbänken in Arkosesandstein<br />
ist es möglich, Kompaktionen von 5:1 bis 7:1 nachzuweisen.<br />
Der nach diesen Erkenntnissen erar<strong>bei</strong>tete Idealschichtenschnitt<br />
zeigt vier deutliche fining-up-Sedimentationszyklen<br />
(Abb. 3.2-2). Vereinfachend kann man sagen, dass der obere<br />
Teil der Döhlen-Formation aus einer palustrischen Folge besteht,<br />
in die lokal wechselnd Pyroklastite, Psammite und Pelite,<br />
durch „air falls“, Schwemmfächer und Rinnensysteme eingetragen<br />
wurden. Generelles Kennzeichen der Teilzyklen sind<br />
die vulkano- (?) tektonische Initiierung mit scharfen Hangendgrenzen<br />
und unterbrochene aber abklingende Subsidenz, bis<br />
zum Stillstand. Diese Sedimentations-„Lücken“ zeigen mehrere<br />
Wurzelböden an.<br />
Durch die sogen. „Flöz-Letten“ (Kohlentonsteine, Pelite und<br />
seit 1957 lokal als „Tonstein“ bezeichnete harte Tuffit-<br />
Pyroklastitlagen) werden die Flöze 1 und 5 in Bänke bzw.<br />
Schichten gegliedert (Feinstratigraphie Abb. 3.2-3, 3.2-4,<br />
3.2-5, 3.2-6, 3.2-7, 3.2-8).<br />
Wegen zahlreicher lithologischer Besonderheiten werden<br />
die Flözletten, die Kohlemazerale und die Kohlelithotypen<br />
vor der lithologischen Abfolge, den Angaben zum<br />
Inkohlungsgrad, zur Rekonstruktion von Faziesmustern und<br />
zu fluviatilen Rinnen, den Bergschüssen, abgehandelt.<br />
3.2.2 Die Letten, Kohlentonsteine und Zwischenmittel<br />
in den Flözen<br />
Als „Letten“ werden bergmännisch allgemein tonige Lagen<br />
oder Kluftausfüllungen (MINEROPHILO 1743: 365) bezeichnet.<br />
HAUSSE deutet sie auf Grund präziser Beobachtungen als<br />
„Zufuhr von feinem tonigen Schlamm“ (1892: 95).<br />
Erstmalig führte STUTZER 1929 den mikroskopischen<br />
Nachweis von pyroklastischen Komponenten. Diese Gesteine<br />
deuteten SCHÜLLER & HOEHNE 1951 als „Kohlentonsteine“.<br />
Ihre Kenntnisse wurden durch REICHEL, 1957, jedoch<br />
vor allen Dingen durch PÄLCHEN 1962 wesentlich erweitert<br />
und präzisiert.<br />
53