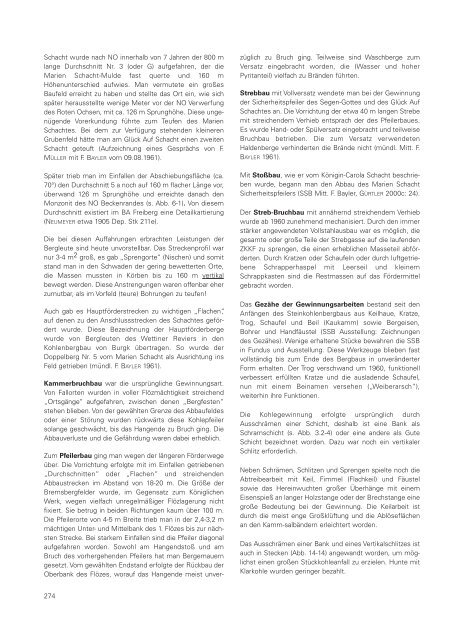Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schacht wurde nach NO innerhalb von 7 Jahren der 800 m<br />
lange Durchschnitt Nr. 3 (oder G) aufgefahren, der die<br />
Marien Schacht-Mulde fast querte und 160 m<br />
Höhenunterschied aufwies. Man vermutete ein großes<br />
Baufeld erreicht zu haben und stellte das Ort ein, wie sich<br />
später herausstellte wenige Meter vor der NO Verwerfung<br />
des Roten Ochsen, mit ca. 126 m Sprunghöhe. Diese ungenügende<br />
Vorerkundung führte zum Teufen des Marien<br />
Schachtes. Bei dem zur Verfügung stehenden kleineren<br />
Grubenfeld hätte man am Glück Auf Schacht einen zweiten<br />
Schacht geteuft (Aufzeichnung eines Gesprächs von F.<br />
MÜLLER mit F. BAYLER vom 09.08.1961).<br />
Später trieb man im Einfallen der Abschiebungsfläche (ca.<br />
70°) den Durchschnitt 5 a noch auf 160 m flacher Länge vor,<br />
überwand 126 m Sprunghöhe und erreichte danach den<br />
Monzonit des NO <strong>Becken</strong>randes (s. Abb. 6-1). Von diesem<br />
Durchschnitt existiert im BA Freiberg eine Detailkartierung<br />
(NEUMEYER etwa 1905 Dep. Stk 211e).<br />
Die <strong>bei</strong> diesen Auffahrungen erbrachten Leistungen der<br />
Bergleute sind heute unvorstellbar. <strong>Das</strong> Streckenprofil war<br />
nur 3-4 m 2 groß, es gab „Sprengorte“ (Nischen) und somit<br />
stand man in den Schwaden der gering bewetterten Orte,<br />
die Massen mussten in Körben bis zu 160 m vertikal<br />
bewegt werden. Diese Anstrengungen waren offenbar eher<br />
zumutbar, als im Vorfeld (teure) Bohrungen zu teufen!<br />
Auch gab es Hauptförderstrecken zu wichtigen „Flachen“,<br />
auf denen zu den Anschlussstrecken des Schachtes gefördert<br />
wurde. Diese Bezeichnung der Hauptförderberge<br />
wurde von Bergleuten des Wettiner Reviers in den<br />
Kohlenbergbau von Burgk übertragen. So wurde der<br />
Doppelberg Nr. 5 vom Marien Schacht als Ausrichtung ins<br />
Feld getrieben (mündl. F. BAYLER 1961).<br />
Kammerbruchbau war die ursprüngliche Gewinnungsart.<br />
Von Fallorten wurden in voller Flözmächtigkeit streichend<br />
„Ortsgänge“ aufgefahren, zwischen denen „Bergfesten“<br />
stehen blieben. Von der gewählten Grenze des Abbaufeldes<br />
oder einer Störung wurden rückwärts diese Kohlepfeiler<br />
solange geschwächt, bis das Hangende zu Bruch ging. Die<br />
Abbauverluste und die Gefährdung waren da<strong>bei</strong> erheblich.<br />
Zum Pfeilerbau ging man wegen der längeren Förderwege<br />
über. Die Vorrichtung erfolgte mit im Einfallen getriebenen<br />
„Durchschnitten“ oder „Flachen“ und streichenden<br />
Abbaustrecken im Abstand von 18-20 m. Die Größe der<br />
Bremsbergfelder wurde, im Gegensatz zum Königlichen<br />
Werk, wegen vielfach unregelmäßiger Flözlagerung nicht<br />
fixiert. Sie betrug in <strong>bei</strong>den Richtungen kaum über 100 m.<br />
Die Pfeilerorte von 4-5 m Breite trieb man in der 2,4-3,2 m<br />
mächtigen Unter- und Mittelbank des 1. Flözes bis zur nächsten<br />
Strecke. Bei starkem Einfallen sind die Pfeiler diagonal<br />
aufgefahren worden. Sowohl am Hangendstoß und am<br />
Bruch des vorhergehenden Pfeilers hat man Bergemauern<br />
gesetzt. Vom gewählten Endstand erfolgte der Rückbau der<br />
Oberbank des Flözes, worauf das Hangende meist unver-<br />
274<br />
züglich zu Bruch ging. Teilweise sind Waschberge zum<br />
Versatz eingebracht worden, die (Wasser und hoher<br />
Pyritanteil) vielfach zu Bränden führten.<br />
Strebbau mit Vollversatz wendete man <strong>bei</strong> der Gewinnung<br />
der Sicherheitspfeiler des Segen-Gottes und des Glück Auf<br />
Schachtes an. Die Vorrichtung der etwa 40 m langen Strebe<br />
mit streichendem Verhieb entsprach der des Pfeilerbaues.<br />
Es wurde Hand- oder Spülversatz eingebracht und teilweise<br />
Bruchbau betrieben. Die zum Versatz verwendeten<br />
Haldenberge verhinderten die Brände nicht (mündl. Mitt. F.<br />
BAYLER 1961).<br />
Mit Stoßbau, wie er vom Königin-Carola Schacht beschrieben<br />
wurde, begann man den Abbau des Marien Schacht<br />
Sicherheitspfeilers (SSB Mitt. F. Bayler, GÜRTLER 2000c: 24).<br />
Der Streb-Bruchbau mit annähernd streichendem Verhieb<br />
wurde ab 1960 zunehmend mechanisiert. Durch den immer<br />
stärker angewendeten Vollstahlausbau war es möglich, die<br />
gesamte oder große Teile der Strebgasse auf die laufenden<br />
ZKKF zu sprengen, die einen erheblichen Masseteil abförderten.<br />
Durch Kratzen oder Schaufeln oder durch luftgetriebene<br />
Schrapperhaspel mit Leerseil und kleinem<br />
Schrappkasten sind die Restmassen auf das Fördermittel<br />
gebracht worden.<br />
<strong>Das</strong> Gezähe der Gewinnungsar<strong>bei</strong>ten bestand seit den<br />
Anfängen des Steinkohlenbergbaus aus Keilhaue, Kratze,<br />
Trog, Schaufel und Beil (Kaukamm) sowie Bergeisen,<br />
Bohrer und Handfäustel (SSB Ausstellung: Zeichnungen<br />
des Gezähes). Wenige erhaltene Stücke bewahren die SSB<br />
in Fundus und Ausstellung. Diese Werkzeuge blieben fast<br />
vollständig bis zum Ende des <strong>Bergbau</strong>s in unveränderter<br />
Form erhalten. Der Trog verschwand um 1960, funktionell<br />
verbessert erfüllten Kratze und die ausladende Schaufel,<br />
nun mit einem Beinamen versehen („Weiberarsch“),<br />
weiterhin ihre Funktionen.<br />
Die Kohlegewinnung erfolgte ursprünglich durch<br />
Ausschrämen einer Schicht, deshalb ist eine Bank als<br />
Schramschicht (s. Abb. 3.2-4) oder eine andere als Gute<br />
Schicht bezeichnet worden. Dazu war noch ein vertikaler<br />
Schlitz erforderlich.<br />
Neben Schrämen, Schlitzen und Sprengen spielte noch die<br />
Abtreibear<strong>bei</strong>t mit Keil, Fimmel (Flachkeil) und Fäustel<br />
sowie das Hereinwuchten großer Überhänge mit einem<br />
Eisenspieß an langer Holzstange oder der Brechstange eine<br />
große Bedeutung <strong>bei</strong> der Gewinnung. Die Keilar<strong>bei</strong>t ist<br />
durch die meist enge Großklüftung und die Ablöseflächen<br />
an den Kamm-salbändern erleichtert worden.<br />
<strong>Das</strong> Ausschrämen einer Bank und eines Vertikalschlitzes ist<br />
auch in Stecken (Abb. 14-14) angewandt worden, um möglichst<br />
einen großen Stückkohleanfall zu erzielen. Hunte mit<br />
Klarkohle wurden geringer bezahlt.