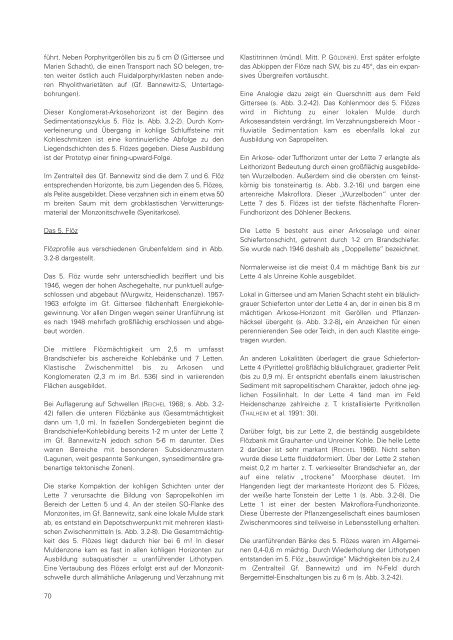Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
führt. Neben Porphyritgeröllen bis zu 5 cm Ø (Gittersee und<br />
Marien Schacht), die einen Transport nach SO belegen, treten<br />
weiter östlich auch Fluidalporphyrklasten neben anderen<br />
Rhyolithvarietäten auf (Gf. Bannewitz-S, Untertagebohrungen).<br />
Dieser Konglomerat-Arkosehorizont ist der Beginn des<br />
Sedimentationszyklus 5. Flöz (s. Abb. 3.2-2). Durch Kornverfeinerung<br />
und Übergang in kohlige Schluffsteine mit<br />
Kohleschmitzen ist eine kontinuierliche Abfolge zu den<br />
Liegendschichten des 5. Flözes gegeben. Diese Ausbildung<br />
ist der Prototyp einer fining-upward-Folge.<br />
Im Zentralteil des Gf. Bannewitz sind die dem 7. und 6. Flöz<br />
entsprechenden Horizonte, bis zum Liegenden des 5. Flözes,<br />
als Pelite ausgebildet. Diese verzahnen sich in einem etwa 50<br />
m breiten Saum mit dem grobklastischen Verwitterungsmaterial<br />
der Monzonitschwelle (Syenitarkose).<br />
<strong>Das</strong> 5. Flöz<br />
Flözprofile aus verschiedenen Grubenfeldern sind in Abb.<br />
3.2-8 dargestellt.<br />
<strong>Das</strong> 5. Flöz wurde sehr unterschiedlich beziffert und bis<br />
1946, wegen der hohen Aschegehalte, nur punktuell aufgeschlossen<br />
und abgebaut (Wurgwitz, Heidenschanze). 1957-<br />
1963 erfolgte im Gf. Gittersee flächenhaft Energiekohlegewinnung.<br />
Vor allen Dingen wegen seiner Uranführung ist<br />
es nach 1948 mehrfach großflächig erschlossen und abgebaut<br />
worden.<br />
Die mittlere Flözmächtigkeit um 2,5 m umfasst<br />
Brandschiefer bis aschereiche Kohlebänke und 7 Letten.<br />
Klastische Zwischenmittel bis zu Arkosen und<br />
Konglomeraten (2,3 m im Brl. 536) sind in variierenden<br />
Flächen ausgebildet.<br />
Bei Auflagerung auf Schwellen (REICHEL 1968; s. Abb. 3.2-<br />
42) fallen die unteren Flözbänke aus (Gesamtmächtigkeit<br />
dann um 1,0 m). In faziellen Sondergebieten beginnt die<br />
Brandschiefer-Kohlebildung bereits 1-2 m unter der Lette 7,<br />
im Gf. Bannewitz-N jedoch schon 5-6 m darunter. Dies<br />
waren Bereiche mit besonderen Subsidenzmustern<br />
(Lagunen, weit gespannte Senkungen, synsedimentäre grabenartige<br />
tektonische Zonen).<br />
Die starke Kompaktion der kohligen Schichten unter der<br />
Lette 7 verursachte die Bildung von Sapropelkohlen im<br />
Bereich der Letten 5 und 4. An der steilen SO-Flanke des<br />
Monzonites, im Gf. Bannewitz, sank eine lokale Mulde stark<br />
ab, es entstand ein Depotschwerpunkt mit mehreren klastischen<br />
Zwischenmitteln (s. Abb. 3.2-8). Die Gesamtmächtigkeit<br />
des 5. Flözes liegt dadurch hier <strong>bei</strong> 6 m! In dieser<br />
Muldenzone kam es fast in allen kohligen Horizonten zur<br />
Ausbildung subaquatischer = uranführender Lithotypen.<br />
Eine Vertaubung des Flözes erfolgt erst auf der Monzonitschwelle<br />
durch allmähliche Anlagerung und Verzahnung mit<br />
70<br />
Klastitrinnen (mündl. Mitt. P. GÖLDNER). Erst später erfolgte<br />
das Abkippen der Flöze nach SW, bis zu 45°, das ein expansives<br />
Übergreifen vortäuscht.<br />
Eine Analogie dazu zeigt ein Querschnitt aus dem Feld<br />
Gittersee (s. Abb. 3.2-42). <strong>Das</strong> Kohlenmoor des 5. Flözes<br />
wird in Richtung zu einer lokalen Mulde durch<br />
Arkosesandstein verdrängt. Im Verzahnungsbereich Moor -<br />
fluviatile Sedimentation kam es ebenfalls lokal zur<br />
Ausbildung von Sapropeliten.<br />
Ein Arkose- oder Tuffhorizont unter der Lette 7 erlangte als<br />
Leithorizont Bedeutung durch einen großflächig ausgebildeten<br />
Wurzelboden. Außerdem sind die obersten cm feinstkörnig<br />
bis tonsteinartig (s. Abb. 3.2-16) und bargen eine<br />
artenreiche Makroflora. Dieser „Wurzelboden“ unter der<br />
Lette 7 des 5. Flözes ist der tiefste flächenhafte Floren-<br />
Fundhorizont des <strong>Döhlener</strong> <strong>Becken</strong>s.<br />
Die Lette 5 besteht aus einer Arkoselage und einer<br />
Schiefertonschicht, getrennt durch 1-2 cm Brandschiefer.<br />
Sie wurde nach 1946 deshalb als „Doppellette“ bezeichnet.<br />
Normalerweise ist die meist 0,4 m mächtige Bank bis zur<br />
Lette 4 als Unreine Kohle ausgebildet.<br />
Lokal in Gittersee und am Marien Schacht steht ein bläulichgrauer<br />
Schieferton unter der Lette 4 an, der in einen bis 8 m<br />
mächtigen Arkose-Horizont mit Geröllen und Pflanzenhäcksel<br />
übergeht (s. Abb. 3.2-8), ein Anzeichen für einen<br />
perennierenden See oder Teich, in den auch Klastite eingetragen<br />
wurden.<br />
An anderen Lokalitäten überlagert die graue Schieferton-<br />
Lette 4 (Pyritlette) großflächig bläulichgrauer, gradierter Pelit<br />
(bis zu 0,9 m). Er entspricht ebenfalls einem lakustrischen<br />
Sediment mit sapropelitischem Charakter, jedoch ohne jeglichen<br />
Fossilinhalt. In der Lette 4 fand man im Feld<br />
Heidenschanze zahlreiche z. T. kristallisierte Pyritknollen<br />
(THALHEIM et al. 1991: 30).<br />
Darüber folgt, bis zur Lette 2, die beständig ausgebildete<br />
Flözbank mit Grauharter- und Unreiner Kohle. Die helle Lette<br />
2 darüber ist sehr markant (REICHEL 1966). Nicht selten<br />
wurde diese Lette fluiddeformiert. Über der Lette 2 stehen<br />
meist 0,2 m harter z. T. verkieselter Brandschiefer an, der<br />
auf eine relativ „trockene“ Moorphase deutet. Im<br />
Hangenden liegt der markanteste Horizont des 5. Flözes,<br />
der weiße harte Tonstein der Lette 1 (s. Abb. 3.2-8). Die<br />
Lette 1 ist einer der besten Makroflora-Fundhorizonte.<br />
Diese Überreste der Pflanzengesellschaft eines baumlosen<br />
Zwischenmoores sind teilweise in Lebensstellung erhalten.<br />
Die uranführenden Bänke des 5. Flözes waren im Allgemeinen<br />
0,4-0,6 m mächtig. Durch Wiederholung der Lithotypen<br />
entstanden im 5. Flöz „bauwürdige“ Mächtigkeiten bis zu 2,4<br />
m (Zentralteil Gf. Bannewitz) und im N-Feld durch<br />
Bergemittel-Einschaltungen bis zu 6 m (s. Abb. 3.2-42).