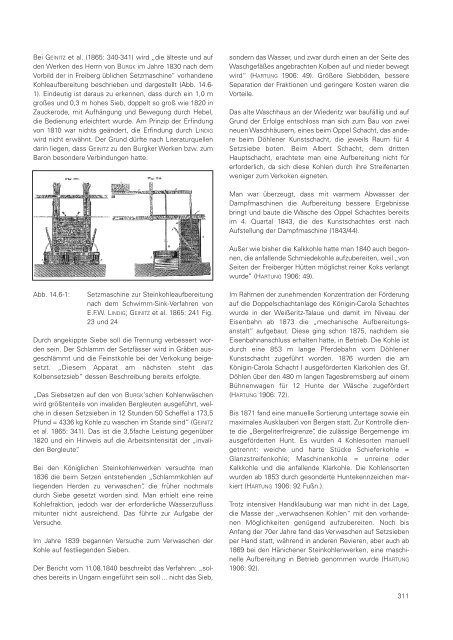Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bei GEINITZ et al. (1865: 340-341) wird „die älteste und auf<br />
den Werken des Herrn von BURGK im Jahre 1830 nach dem<br />
Vorbild der in Freiberg üblichen Setzmaschine“ vorhandene<br />
Kohleaufbereitung beschrieben und dargestellt (Abb. 14.6-<br />
1). Eindeutig ist daraus zu erkennen, dass durch ein 1,0 m<br />
großes und 0,3 m hohes Sieb, doppelt so groß wie 1820 in<br />
Zauckerode, mit Aufhängung und Bewegung durch Hebel,<br />
die Bedienung erleichtert wurde. Am Prinzip der Erfindung<br />
von 1810 war nichts geändert, die Erfindung durch LINDIG<br />
wird nicht erwähnt. Der Grund dürfte nach Literaturquellen<br />
darin liegen, dass GEINITZ zu den Burgker Werken bzw. zum<br />
Baron besondere Verbindungen hatte.<br />
Abb. 14.6-1: Setzmaschine zur Steinkohleaufbereitung<br />
nach dem Schwimm-Sink-Verfahren von<br />
E.F.W. LINDIG; GEINITZ et al. 1865: 241 Fig.<br />
23 und 24<br />
Durch angekippte Siebe soll die Trennung verbessert worden<br />
sein. Der Schlamm der Setzfässer wird in Gräben ausgeschlämmt<br />
und die Feinstkohle <strong>bei</strong> der Verkokung <strong>bei</strong>gesetzt.<br />
„Diesem Apparat am nächsten steht das<br />
Kolbensetzsieb“ dessen Beschreibung bereits erfolgte.<br />
„<strong>Das</strong> Siebsetzen auf den von BURGK’schen Kohlenwäschen<br />
wird größtenteils von invaliden Bergleuten ausgeführt, welche<br />
in diesen Setzsieben in 12 Stunden 50 Scheffel a 173,5<br />
Pfund = 4336 kg Kohle zu waschen im Stande sind“ (GEINITZ<br />
et al. 1865: 341). <strong>Das</strong> ist die 3,5fache Leistung gegenüber<br />
1820 und ein Hinweis auf die Ar<strong>bei</strong>tsintensität der „invaliden<br />
Bergleute“.<br />
Bei den Königlichen Steinkohlenwerken versuchte man<br />
1836 die <strong>bei</strong>m Setzen entstehenden „Schlammkohlen auf<br />
liegenden Herden zu verwaschen“, die früher nochmals<br />
durch Siebe gesetzt worden sind. Man erhielt eine reine<br />
Kohlefraktion, jedoch war der erforderliche Wasserzufluss<br />
mitunter nicht ausreichend. <strong>Das</strong> führte zur Aufgabe der<br />
Versuche.<br />
Im Jahre 1839 begannen Versuche zum Verwaschen der<br />
Kohle auf festliegenden Sieben.<br />
Der Bericht vom 11.08.1840 beschreibt das Verfahren: „solches<br />
bereits in Ungarn eingeführt sein soll ... nicht das Sieb,<br />
sondern das Wasser, und zwar durch einen an der Seite des<br />
Waschgefäßes angebrachten Kolben auf und nieder bewegt<br />
wird“ (HARTUNG 1906: 49). Größere Siebböden, bessere<br />
Separation der Fraktionen und geringere Kosten waren die<br />
Vorteile.<br />
<strong>Das</strong> alte Waschhaus an der Wiederitz war baufällig und auf<br />
Grund der Erfolge entschloss man sich zum Bau von zwei<br />
neuen Waschhäusern, eines <strong>bei</strong>m Oppel Schacht, das andere<br />
<strong>bei</strong>m <strong>Döhlener</strong> Kunstschacht, die jeweils Raum für 4<br />
Setzsiebe boten. Beim Albert Schacht, dem dritten<br />
Hauptschacht, erachtete man eine Aufbereitung nicht für<br />
erforderlich, da sich diese Kohlen durch ihre Streifenarten<br />
weniger zum Verkoken eigneten.<br />
Man war überzeugt, dass mit warmem Abwasser der<br />
Dampfmaschinen die Aufbereitung bessere Ergebnisse<br />
bringt und baute die Wäsche des Oppel Schachtes bereits<br />
im 4. Quartal 1843, die des Kunstschachtes erst nach<br />
Aufstellung der Dampfmaschine (1843/44).<br />
Außer wie bisher die Kalkkohle hatte man 1840 auch begonnen,<br />
die anfallende Schmiedekohle aufzubereiten, weil „von<br />
Seiten der Freiberger Hütten möglichst reiner Koks verlangt<br />
wurde” (HARTUNG 1906: 49).<br />
Im Rahmen der zunehmenden Konzentration der Förderung<br />
auf die Doppelschachtanlage des Königin-Carola Schachtes<br />
wurde in der Weißeritz-Talaue und damit im Niveau der<br />
Eisenbahn ab 1873 die „mechanische Aufbereitungsanstalt“<br />
aufgebaut. Diese ging schon 1875, nachdem sie<br />
Eisenbahnanschluss erhalten hatte, in Betrieb. Die Kohle ist<br />
durch eine 853 m lange Pferdebahn vom <strong>Döhlener</strong><br />
Kunstschacht zugeführt worden. 1876 wurden die am<br />
Königin-Carola Schacht I ausgeförderten Klarkohlen des Gf.<br />
Döhlen über den 480 m langen Tagesbremsberg auf einem<br />
Bühnenwagen für 12 Hunte der Wäsche zugefördert<br />
(HARTUNG 1906: 72).<br />
Bis 1871 fand eine manuelle Sortierung untertage sowie ein<br />
maximales Ausklauben von Bergen statt. Zur Kontrolle diente<br />
die „Bergeliterfreigrenze“, die zulässige Bergemenge im<br />
ausgeförderten Hunt. Es wurden 4 Kohlesorten manuell<br />
getrennt: weiche und harte Stücke Schieferkohle =<br />
Glanzstreifenkohle; Maschinenkohle = unreine oder<br />
Kalkkohle und die anfallende Klarkohle. Die Kohlensorten<br />
wurden ab 1853 durch gesonderte Huntekennzeichen markiert<br />
(HARTUNG 1906: 92 Fußn.).<br />
Trotz intensiver Handklaubung war man nicht in der Lage,<br />
die Masse der „verwachsenen Kohlen“ mit den vorhandenen<br />
Möglichkeiten genügend aufzubereiten. Noch bis<br />
Anfang der 70er Jahre fand das Verwaschen auf Setzsieben<br />
per Hand statt, während in anderen Revieren, aber auch ab<br />
1869 <strong>bei</strong> den Hänichener Steinkohlenwerken, eine maschinelle<br />
Aufbereitung in Betrieb genommen wurde (HARTUNG<br />
1906: 92).<br />
311