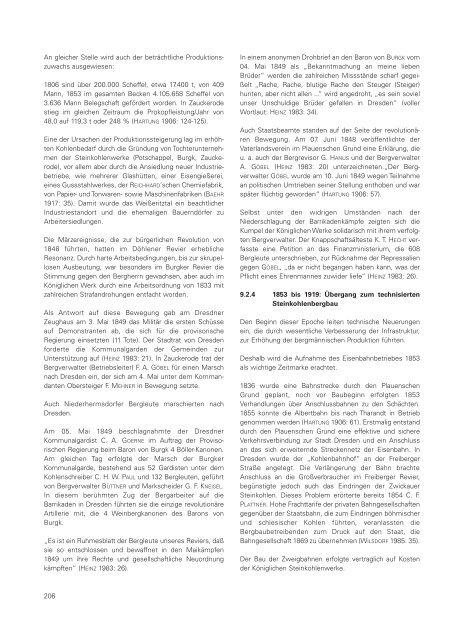Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
An gleicher Stelle wird auch der beträchtliche Produktionszuwachs<br />
ausgewiesen:<br />
1806 sind über 200.000 Scheffel, etwa 17.400 t, von 409<br />
Mann, 1853 im gesamten <strong>Becken</strong> 4.105.658 Scheffel von<br />
3.636 Mann Belegschaft gefördert worden. In Zauckerode<br />
stieg im gleichen Zeitraum die Prokopfleistung/Jahr von<br />
48,0 auf 119,3 t oder 248 % (HARTUNG 1906: 124-125).<br />
Eine der Ursachen der Produktionssteigerung lag im erhöhten<br />
Kohlenbedarf durch die Gründung von Tochterunternehmen<br />
der Steinkohlenwerke (Potschappel, Burgk, Zauckerode),<br />
vor allem aber durch die Ansiedlung neuer Industriebetriebe,<br />
wie mehrerer Glashütten, einer Eisengießerei,<br />
eines Gussstahlwerkes, der REICHHARD’schen Chemiefabrik,<br />
von Papier- und Tonwaren- sowie Maschinenfabriken (BAEHR<br />
1917: 35). Damit wurde das Weißeritztal ein beachtlicher<br />
Industriestandort und die ehemaligen Bauerndörfer zu<br />
Ar<strong>bei</strong>tersiedlungen.<br />
Die Märzereignisse, die zur bürgerlichen Revolution von<br />
1848 führten, hatten im <strong>Döhlener</strong> Revier erhebliche<br />
Resonanz. Durch harte Ar<strong>bei</strong>tsbedingungen, bis zur skrupellosen<br />
Ausbeutung, war besonders im Burgker Revier die<br />
Stimmung gegen den Bergherrn gewachsen, aber auch im<br />
Königlichen Werk durch eine Ar<strong>bei</strong>tsordnung von 1833 mit<br />
zahlreichen Strafandrohungen entfacht worden.<br />
Als Antwort auf diese Bewegung gab am Dresdner<br />
Zeughaus am 3. Mai 1849 das Militär die ersten Schüsse<br />
auf Demonstranten ab, die sich für die provisorische<br />
Regierung einsetzten (11 Tote). Der Stadtrat von <strong>Dresden</strong><br />
forderte die Kommunalgarden der Gemeinden zur<br />
Unterstützung auf (HEINZ 1983: 21). In Zauckerode trat der<br />
Bergverwalter (Betriebsleiter) F. A. GÖBEL für einen Marsch<br />
nach <strong>Dresden</strong> ein, der sich am 4. Mai unter dem Kommandanten<br />
Obersteiger F. MEHNER in Bewegung setzte.<br />
Auch Niederhermsdorfer Bergleute marschierten nach<br />
<strong>Dresden</strong>.<br />
Am 05. Mai 1849 beschlagnahmte der Dresdner<br />
Kommunalgardist C. A. GOERNE im Auftrag der Provisorischen<br />
Regierung <strong>bei</strong>m Baron von Burgk 4 Böller-Kanonen.<br />
Am gleichen Tag erfolgte der Marsch der Burgker<br />
Kommunalgarde, bestehend aus 52 Gardisten unter dem<br />
Kohlenschreiber C. H. W. PAUL und 132 Bergleuten, geführt<br />
von Bergverwalter BÜTTNER und Markscheider G. F. KNEISEL.<br />
In diesem berühmten Zug der Bergar<strong>bei</strong>ter auf die<br />
Barrikaden in <strong>Dresden</strong> führten sie die einzige revolutionäre<br />
Artillerie mit, die 4 Weinbergkanonen des Barons von<br />
Burgk.<br />
„Es ist ein Ruhmesblatt der Bergleute unseres Reviers, daß<br />
sie so entschlossen und bewaffnet in den Maikämpfen<br />
1849 um ihre Rechte und gesellschaftliche Neuordnung<br />
kämpften“ (HEINZ 1983: 26).<br />
206<br />
In einem anonymen Drohbrief an den Baron von BURGK vom<br />
04. Mai 1849 als „Bekanntmachung an meine lieben<br />
Brüder“ werden die zahlreichen Missstände scharf gegeißelt<br />
„Rache, Rache, blutige Rache den Steuger (Steiger)<br />
hunten, aber nicht allen ...“ wird angedroht, „es sein soviel<br />
unser Unschuldige Brüder gefallen in <strong>Dresden</strong>“ (voller<br />
Wortlaut: HEINZ 1983: 34).<br />
Auch Staatsbeamte standen auf der Seite der revolutionären<br />
Bewegung. Am 07. Juni 1848 veröffentlichte der<br />
Vaterlandsverein im Plauenschen Grund eine Erklärung, die<br />
u. a. auch der Bergrevisor G. HANUS und der Bergverwalter<br />
A. GÖBEL (HEINZ 1983: 20) unterzeichneten.„Der Bergverwalter<br />
GÖBEL wurde am 10. Juni 1849 wegen Teilnahme<br />
an politischen Umtrieben seiner Stellung enthoben und war<br />
später flüchtig geworden“ (HARTUNG 1906: 57).<br />
Selbst unter den widrigen Umständen nach der<br />
Niederschlagung der Barrikadenkämpfe zeigten sich die<br />
Kumpel der Königlichen Werke solidarisch mit ihrem verfolgten<br />
Bergverwalter. Der Knappschaftsälteste K. T. HECHT verfasste<br />
eine Petition an das Finanzministerium, die 608<br />
Bergleute unterschrieben, zur Rücknahme der Repressalien<br />
gegen GÖBEL, „da er nicht begangen haben kann, was der<br />
Pflicht eines Ehrenmannes zuwider liefe“ (HEINZ 1983: 26).<br />
9.2.4 1853 bis 1919: Übergang zum technisierten<br />
Steinkohlenbergbau<br />
Den Beginn dieser Epoche leiten technische Neuerungen<br />
ein, die durch wesentliche Verbesserung der Infrastruktur,<br />
zur Erhöhung der bergmännischen Produktion führten.<br />
Deshalb wird die Aufnahme des Eisenbahnbetriebes 1853<br />
als wichtige Zeitmarke erachtet.<br />
1836 wurde eine Bahnstrecke durch den Plauenschen<br />
Grund geplant, noch vor Baubeginn erfolgten 1853<br />
Verhandlungen über Anschlussbahnen zu den Schächten.<br />
1855 konnte die Albertbahn bis nach Tharandt in Betrieb<br />
genommen werden (HARTUNG 1906: 61). Erstmalig entstand<br />
durch den Plauenschen Grund eine effektive und sichere<br />
Verkehrsverbindung zur Stadt <strong>Dresden</strong> und ein Anschluss<br />
an das sich erweiternde Streckennetz der Eisenbahn. In<br />
<strong>Dresden</strong> wurde der „Kohlenbahnhof“ an der Freiberger<br />
Straße angelegt. Die Verlängerung der Bahn brachte<br />
Anschluss an die Großverbraucher im Freiberger Revier,<br />
begünstigte jedoch auch das Eindringen der Zwickauer<br />
Steinkohlen. Dieses Problem erörterte bereits 1854 C. F.<br />
PLATTNER. Hohe Frachttarife der privaten Bahngesellschaften<br />
gegenüber der Staatsbahn, die zum Eindringen böhmischer<br />
und schlesischer Kohlen führten, veranlassten die<br />
<strong>Bergbau</strong>betreibenden zum Druck auf den Staat, die<br />
Bahngesellschaft 1869 zu übernehmen (WILSDORF 1985: 35).<br />
Der Bau der Zweigbahnen erfolgte vertraglich auf Kosten<br />
der Königlichen Steinkohlenwerke.