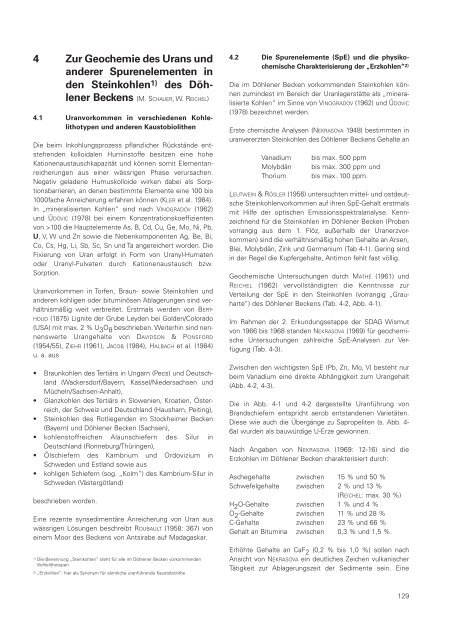Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4 Zur Geochemie des Urans und<br />
anderer Spurenelementen in<br />
den Steinkohlen 1) des <strong>Döhlener</strong><br />
<strong>Becken</strong>s (M. SCHAUER, W. REICHEL)<br />
4.1 Uranvorkommen in verschiedenen Kohlelithotypen<br />
und anderen Kaustobiolithen<br />
Die <strong>bei</strong>m Inkohlungsprozess pflanzlicher Rückstände entstehenden<br />
kolloidalen Huminstoffe besitzen eine hohe<br />
Kationenaustauschkapazität und können somit Elementanreicherungen<br />
aus einer wässrigen Phase verursachen.<br />
Negativ geladene Humuskolloide wirken da<strong>bei</strong> als Sorptionsbarrieren,<br />
an denen bestimmte Elemente eine 100 bis<br />
1000fache Anreicherung erfahren können (KLER et al. 1984).<br />
In „mineralisierten Kohlen“ sind nach VINOGRADOV (1962)<br />
und ÛDOVIC (1978) <strong>bei</strong> einem Konzentrationskoeffizienten<br />
von >100 die Hauptelemente As, B, Cd, Cu, Ge, Mo, Ni, Pb,<br />
U, V, W und Zn sowie die Nebenkomponenten Ag, Be, Bi,<br />
Co, Cs, Hg, Li, Sb, Sc, Sn und Ta angereichert worden. Die<br />
Fixierung von Uran erfolgt in Form von Uranyl-Humaten<br />
oder Uranyl-Fulvaten durch Kationenaustausch bzw.<br />
Sorption.<br />
Uranvorkommen in Torfen, Braun- sowie Steinkohlen und<br />
anderen kohligen oder bituminösen Ablagerungen sind verhältnismäßig<br />
weit verbreitet. Erstmals werden von BERT-<br />
HOUD (1875) Lignite der Grube Leyden <strong>bei</strong> Golden/Colorado<br />
(USA) mit max. 2 % U 3 O 8 beschrieben. Weiterhin sind nennenswerte<br />
Urangehalte von DAVIDSON & PONSFORD<br />
(1954/55), ZIEHR (1961), JACOB (1984), HALBACH et al. (1984)<br />
u. a. aus<br />
• Braunkohlen des Tertiärs in Ungarn (Pecs) und Deutschland<br />
(Wackersdorf/Bayern, Kassel/Niedersachsen und<br />
Mücheln/Sachsen-Anhalt),<br />
• Glanzkohlen des Tertiärs in Slowenien, Kroatien, Österreich,<br />
der Schweiz und Deutschland (Hausham, Peiting),<br />
• Steinkohlen des Rotliegenden im Stockheimer <strong>Becken</strong><br />
(Bayern) und <strong>Döhlener</strong> <strong>Becken</strong> (Sachsen),<br />
• kohlenstoffreichen Alaunschiefern des Silur in<br />
Deutschland (Ronneburg/Thüringen),<br />
• Ölschiefern des Kambrium und Ordovizium in<br />
Schweden und Estland sowie aus<br />
• kohligen Schiefern (sog. „Kolm“) des Kambrium-Silur in<br />
Schweden (Västergötland)<br />
beschrieben worden.<br />
Eine rezente synsedimentäre Anreicherung von Uran aus<br />
wässrigen Lösungen beschreibt ROUBAULT (1958: 367) von<br />
einem Moor des <strong>Becken</strong>s von Antsirabe auf Madagaskar.<br />
1) Die Benennung „Steinkohlen” steht für alle im <strong>Döhlener</strong> <strong>Becken</strong> vorkommenden<br />
Kohlelithotypen<br />
2) „Erzkohlen”: hier als Synonym für sämtliche uranführende Kaustobiolithe<br />
4.2 Die Spurenelemente (SpE) und die physikochemische<br />
Charakterisierung der „Erzkohlen“ 2)<br />
Die im <strong>Döhlener</strong> <strong>Becken</strong> vorkommenden Steinkohlen können<br />
zumindest im Bereich der Uranlagerstätte als „mineralisierte<br />
Kohlen“ im Sinne von VINOGRADOV (1962) und ÛDOVIC<br />
(1978) bezeichnet werden.<br />
Erste chemische Analysen (NEKRASOVA 1948) bestimmten in<br />
uranvererzten Steinkohlen des <strong>Döhlener</strong> <strong>Becken</strong>s Gehalte an<br />
Vanadium bis max. 500 ppm<br />
Molybdän bis max. 300 ppm und<br />
Thorium bis max. 100 ppm.<br />
LEUTWEIN & RÖSLER (1956) untersuchten mittel- und ostdeutsche<br />
Steinkohlenvorkommen auf ihren SpE-Gehalt erstmals<br />
mit Hilfe der optischen Emissionsspektralanalyse. Kennzeichnend<br />
für die Steinkohlen im <strong>Döhlener</strong> <strong>Becken</strong> (Proben<br />
vorrangig aus dem 1. Flöz, außerhalb der Uranerzvorkommen)<br />
sind die verhältnismäßig hohen Gehalte an Arsen,<br />
Blei, Molybdän, Zink und Germanium (Tab 4-1). Gering sind<br />
in der Regel die Kupfergehalte, Antimon fehlt fast völlig.<br />
Geochemische Untersuchungen durch MATHÉ (1961) und<br />
REICHEL (1962) vervollständigten die Kenntnisse zur<br />
Verteilung der SpE in den Steinkohlen (vorrangig „Grauharte“)<br />
des <strong>Döhlener</strong> <strong>Becken</strong>s (Tab. 4-2, Abb. 4-1).<br />
Im Rahmen der 2. Erkundungsetappe der SDAG Wismut<br />
von 1966 bis 1968 standen NEKRASOVA (1969) für geochemische<br />
Untersuchungen zahlreiche SpE-Analysen zur Verfügung<br />
(Tab. 4-3).<br />
Zwischen den wichtigsten SpE (Pb, Zn, Mo, V) besteht nur<br />
<strong>bei</strong>m Vanadium eine direkte Abhängigkeit zum Urangehalt<br />
(Abb. 4-2, 4-3).<br />
Die in Abb. 4-1 und 4-2 dargestellte Uranführung von<br />
Brandschiefern entspricht aerob entstandenen Varietäten.<br />
Diese wie auch die Übergänge zu Sapropeliten (s. Abb. 4-<br />
6a) wurden als bauwürdige U-Erze gewonnen.<br />
Nach Angaben von NEKRASOVA (1969: 12-16) sind die<br />
Erzkohlen im <strong>Döhlener</strong> <strong>Becken</strong> charakterisiert durch:<br />
Aschegehalte zwischen 15 % und 50 %<br />
Schwefelgehalte zwischen 2 % und 13 %<br />
(REICHEL: max. 30 %)<br />
H 2 O-Gehalte zwischen 1 % und 4 %<br />
O 2 -Gehalte zwischen 11 % und 28 %<br />
C-Gehalte zwischen 23 % und 66 %<br />
Gehalt an Bitumina zwischen 0,3 % und 1,5 %.<br />
Erhöhte Gehalte an CaF 2 (0,2 % bis 1,0 %) sollen nach<br />
Ansicht von NEKRASOVA ein deutliches Zeichen vulkanischer<br />
Tätigkeit zur Ablagerungszeit der Sedimente sein. Eine<br />
129