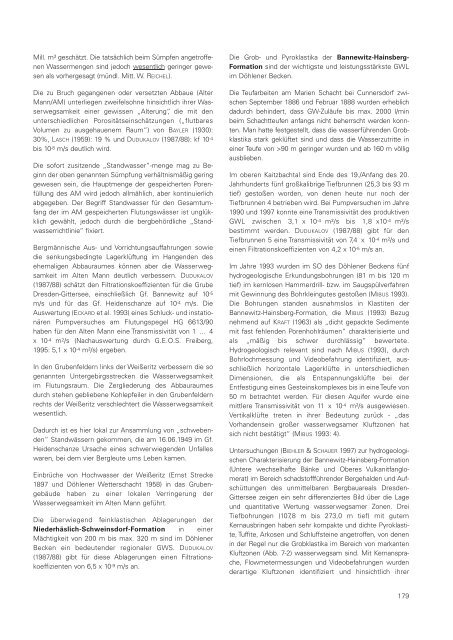Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Mill. m³ geschätzt. Die tatsächlich <strong>bei</strong>m Sümpfen angetroffenen<br />
Wassermengen sind jedoch wesentlich geringer gewesen<br />
als vorhergesagt (mündl. Mitt. W. REICHEL).<br />
Die zu Bruch gegangenen oder versetzten Abbaue (Alter<br />
Mann/AM) unterliegen zweifelsohne hinsichtlich ihrer Wasserwegsamkeit<br />
einer gewissen „Alterung“, die mit den<br />
unterschiedlichen Porositätseinschätzungen („flutbares<br />
Volumen zu ausgehauenem Raum“) von BAYLER (1930):<br />
30%, LASCH (1959): 19 % und DUDUKALOV (1987/88): kf 10 -4<br />
bis 10 -8 m/s deutlich wird.<br />
Die sofort zusitzende „Standwasser“-menge mag zu Beginn<br />
der oben genannten Sümpfung verhältnismäßig gering<br />
gewesen sein, die Hauptmenge der gespeicherten Porenfüllung<br />
des AM wird jedoch allmählich, aber kontinuierlich<br />
abgegeben. Der Begriff Standwasser für den Gesamtumfang<br />
der im AM gespeicherten Flutungswässer ist unglükklich<br />
gewählt, jedoch durch die bergbehördliche „Standwasserrichtlinie“<br />
fixiert.<br />
Bergmännische Aus- und Vorrichtungsauffahrungen sowie<br />
die senkungsbedingte Lagerklüftung im Hangenden des<br />
ehemaligen Abbauraumes können aber die Wasserwegsamkeit<br />
im Alten Mann deutlich verbessern. DUDUKALOV<br />
(1987/88) schätzt den Filtrationskoeffizienten für die Grube<br />
<strong>Dresden</strong>-Gittersee, einschließlich Gf. Bannewitz auf 10 -5<br />
m/s und für das Gf. Heidenschanze auf 10 -4 m/s. Die<br />
Auswertung (ECKARD et al. 1993) eines Schluck- und instationären<br />
Pumpversuches am Flutungspegel HG 6613/90<br />
haben für den Alten Mann eine Transmissivität von 1 ... 4<br />
x 10 -4 m 2/s (Nachauswertung durch G.E.O.S. Freiberg,<br />
1995: 5,1 x 10 -4 m²/s) ergeben.<br />
In den Grubenfeldern links der Weißeritz verbessern die so<br />
genannten Untergebirgsstrecken die Wasserwegsamkeit<br />
im Flutungsraum. Die Zergliederung des Abbauraumes<br />
durch stehen gebliebene Kohlepfeiler in den Grubenfeldern<br />
rechts der Weißeritz verschlechtert die Wasserwegsamkeit<br />
wesentlich.<br />
Dadurch ist es hier lokal zur Ansammlung von „schwebenden“<br />
Standwässern gekommen, die am 16.06.1949 im Gf.<br />
Heidenschanze Ursache eines schwerwiegenden Unfalles<br />
waren, <strong>bei</strong> dem vier Bergleute ums Leben kamen.<br />
Einbrüche von Hochwasser der Weißeritz (Ernst Strecke<br />
1897 und <strong>Döhlener</strong> Wetterschacht 1958) in das Grubengebäude<br />
haben zu einer lokalen Verringerung der<br />
Wasserwegsamkeit im Alten Mann geführt.<br />
Die überwiegend feinklastischen Ablagerungen der<br />
Niederhäslich-Schweinsdorf-Formation in einer<br />
Mächtigkeit von 200 m bis max. 320 m sind im <strong>Döhlener</strong><br />
<strong>Becken</strong> ein bedeutender regionaler GWS. DUDUKALOV<br />
(1987/88) gibt für diese Ablagerungen einen Filtrationskoeffizienten<br />
von 6,5 x 10 -9 m/s an.<br />
Die Grob- und Pyroklastika der Bannewitz-Hainsberg-<br />
Formation sind der wichtigste und leistungsstärkste GWL<br />
im <strong>Döhlener</strong> <strong>Becken</strong>.<br />
Die Teufar<strong>bei</strong>ten am Marien Schacht <strong>bei</strong> Cunnersdorf zwischen<br />
September 1886 und Februar 1888 wurden erheblich<br />
dadurch behindert, dass GW-Zuläufe bis max. 2000 l/min<br />
<strong>bei</strong>m Schachtteufen anfangs nicht beherrscht werden konnten.<br />
Man hatte festgestellt, dass die wasserführenden Grobklastika<br />
stark geklüftet sind und dass die Wasserzutritte in<br />
einer Teufe von >90 m geringer wurden und ab 160 m völlig<br />
ausblieben.<br />
Im oberen Kaitzbachtal sind Ende des 19./Anfang des 20.<br />
Jahrhunderts fünf großkalibrige Tiefbrunnen (25,3 bis 93 m<br />
tief) gestoßen worden, von denen heute nur noch der<br />
Tiefbrunnen 4 betrieben wird. Bei Pumpversuchen im Jahre<br />
1990 und 1997 konnte eine Transmissivität des produktiven<br />
GWL zwischen 3,1 x 10 -4 m²/s bis 1,8 x10 -4 m²/s<br />
bestimmt werden. DUDUKALOV (1987/88) gibt für den<br />
Tiefbrunnen 5 eine Transmissivität von 7,4 x 10 -4 m²/s und<br />
einen Filtrationskoeffizienten von 4,2 x 10 -5 m/s an.<br />
Im Jahre 1993 wurden im SO des <strong>Döhlener</strong> <strong>Becken</strong>s fünf<br />
hydrogeologische Erkundungsbohrungen (81 m bis 120 m<br />
tief) im kernlosen Hammerdrill- bzw. im Saugspülverfahren<br />
mit Gewinnung des Bohrkleingutes gestoßen (MIBUS 1993).<br />
Die Bohrungen standen ausnahmslos in Klastiten der<br />
Bannewitz-Hainsberg-Formation, die MIBUS (1993) Bezug<br />
nehmend auf KRAFT (1963) als „dicht gepackte Sedimente<br />
mit fast fehlenden Porenhohlräumen“ charakterisierte und<br />
als „mäßig bis schwer durchlässig“ bewertete.<br />
Hydrogeologisch relevant sind nach MIBUS (1993), durch<br />
Bohrlochmessung und Videobefahrung identifiziert, ausschließlich<br />
horizontale Lagerklüfte in unterschiedlichen<br />
Dimensionen, die als Entspannungsklüfte <strong>bei</strong> der<br />
Entfestigung eines Gesteinskomplexes bis in eine Teufe von<br />
50 m betrachtet werden. Für diesen Aquifer wurde eine<br />
mittlere Transmissivität von 11 x 10 -4 m²/s ausgewiesen.<br />
Vertikalklüfte treten in ihrer Bedeutung zurück - „das<br />
Vorhandensein großer wasserwegsamer Kluftzonen hat<br />
sich nicht bestätigt“ (MIBUS 1993: 4).<br />
Untersuchungen (BIEHLER & SCHAUER 1997) zur hydrogeologischen<br />
Charakterisierung der Bannewitz-Hainsberg-Formation<br />
(Untere wechselhafte Bänke und Oberes Vulkanitfanglomerat)<br />
im Bereich schadstoffführender Bergehalden und Aufschüttungen<br />
des unmittelbaren <strong>Bergbau</strong>areals <strong>Dresden</strong>-<br />
Gittersee zeigen ein sehr differenziertes Bild über die Lage<br />
und quantitative Wertung wasserwegsamer Zonen. Drei<br />
Tiefbohrungen (107,8 m bis 273,0 m tief) mit gutem<br />
Kernausbringen haben sehr kompakte und dichte Pyroklastite,<br />
Tuffite, Arkosen und Schluffsteine angetroffen, von denen<br />
in der Regel nur die Grobklastika im Bereich von markanten<br />
Kluftzonen (Abb. 7-2) wasserwegsam sind. Mit Kernansprache,<br />
Flowmetermessungen und Videobefahrungen wurden<br />
derartige Kluftzonen identifiziert und hinsichtlich ihrer<br />
179