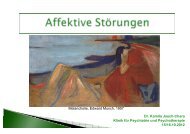- Seite 1 und 2:
FOCUS MUL Zeitschrift für Wissensc
- Seite 3:
Inhalt 1. Vorwort .................
- Seite 7:
2. Forschungsberichte der Kliniken
- Seite 10 und 11:
4 Blömer, Petra, Dr. med. Boving,
- Seite 12 und 13:
Bereich Intensivstation 15i Die an
- Seite 14 und 15:
sagen • Psychologie und Stress in
- Seite 16 und 17:
Vorstand der Deutschen Gesellschaft
- Seite 18 und 19:
wissenschaftlich untersucht werden,
- Seite 20 und 21:
Bearbeiter: PD Dr. M. Heringlake, P
- Seite 22 und 23:
• Untersuchung zur Messung des po
- Seite 24 und 25:
Verständnis der lokalen Ventilatio
- Seite 26 und 27:
Problembeschreibung auch mögliche
- Seite 28 und 29:
• Geschichte der Anaesthesiologie
- Seite 30 und 31:
Biology, University of Iowa, Instit
- Seite 32 und 33:
Transkription von Entzündungsmedia
- Seite 34 und 35:
kontinuierlichen Spinalanästhesie
- Seite 36 und 37:
Antidepressivum Opipramol Die medik
- Seite 38 und 39:
Bedeutung einer hodenspezifischen H
- Seite 40 und 41:
Auswirkungen der Anästhesie auf da
- Seite 42 und 43:
03. Bahlmann L, Markert U, Wirts C,
- Seite 44 und 45:
effects of infused fluids in an in
- Seite 46 und 47:
61. Matz H, Pahls H, Gönne M, Gehr
- Seite 48 und 49:
Akademie für Ethik in der Medizin.
- Seite 51 und 52:
2.02 Klinik für Augenheilkunde Dir
- Seite 53 und 54:
Die Vorhaben der Augenklinik insges
- Seite 55 und 56:
Skleragetragene gasdurchlässige Ko
- Seite 57 und 58:
Bearbeiter: PD Dr. G. Geerling, F.
- Seite 59 und 60:
Optische Kohärenztomographie Der E
- Seite 61 und 62:
das Adhärenzverhalten Endophthalmi
- Seite 63 und 64:
2.03 Klinik für Chirurgie Direktor
- Seite 65 und 66:
Gesamtdarstellung - Leistungsberich
- Seite 67 und 68:
Chirurgische Diagnostik Die Fusion
- Seite 69 und 70:
23.11.2003 • Wet lab Workshop „
- Seite 71 und 72:
Berufungen • Ernennungen • Ehru
- Seite 73 und 74:
Dr. R. Keller Tutor beim Symposium
- Seite 75 und 76:
k-ras auf die Expression des Vascul
- Seite 77 und 78:
in der Proktologie (PPH-Hämorrhoid
- Seite 79 und 80:
publiziert und beachtet wurden. Die
- Seite 81 und 82:
Initiative Forschungsschwerpunkt St
- Seite 83 und 84:
Low-dose Immunsuppression mit Tacro
- Seite 85 und 86:
Häufigkeitsverteilung, Behandlung
- Seite 87 und 88:
Untersuchung systemischer Begleitfo
- Seite 89 und 90:
Evaluation der Nierenlebendspende a
- Seite 91 und 92:
Untersuchung des Einflusses des ind
- Seite 93 und 94:
Immunhistochemischer Nachweis von n
- Seite 95 und 96:
Placebo controlled, multicentre, ra
- Seite 97 und 98:
gespräch: Risiko der laparoskopisc
- Seite 99 und 100:
49. Ihmann T, Liu J, Schwabe W, Hä
- Seite 101 und 102:
sorbent assay. Dis Colon Rectum 46:
- Seite 103 und 104:
Mundt S, Pox C, Reinshagen M, Reiss
- Seite 105 und 106:
2.04 Klinik für Dermatologie und V
- Seite 107 und 108:
Forschung Die Kernpunkte der dermat
- Seite 109 und 110:
• Arbeitsgruppe Blasenbildende Au
- Seite 111 und 112:
meter. Dazu werden in Kooperation m
- Seite 113 und 114:
Bioengineering-Methoden ermögliche
- Seite 115 und 116:
Die Rolle von basophilen Granulozyt
- Seite 117 und 118:
Entartungsrisiko kongenitaler Nävi
- Seite 119 und 120:
Monitoring von Wundheilung mittels
- Seite 121 und 122:
25. Schmausser B, Josenhans C, Endr
- Seite 123 und 124:
2.05 Klinik für Frauenheilkunde un
- Seite 125 und 126:
160 • Intracytoplasmatische Sperm
- Seite 127 und 128:
Operative Laparoskopien Kleine Eing
- Seite 129 und 130:
• "Bridge-1 Signaling Regulates P
- Seite 131 und 132:
werden im Westernblot evaluiert und
- Seite 133 und 134:
Revitalisierung der Subjektivität
- Seite 135 und 136:
Querschnittstudie Familienstruktur
- Seite 137 und 138:
des Photosensitizers Protoporphyrin
- Seite 139 und 140:
Komplikationen nach transvaginaler
- Seite 141 und 142:
09. Axt-Fliedner R, Wiegank U, Frie
- Seite 143 und 144:
37. Hornung D, Chao VA,Vigne JL,Wal
- Seite 145 und 146:
67. Schröder AK, Schöpper B, Al-H
- Seite 147 und 148:
20. Friedrich M, Fersis N, Felberba
- Seite 149 und 150:
51. Löning M, Altgassen C, Friedri
- Seite 151 und 152:
76. Schultze-Mosgau A, Felberbaum R
- Seite 153 und 154:
2.06 Klinik für Hals-, Nasen- und
- Seite 155 und 156:
apie sämtlicher hals-nasen-ohrenä
- Seite 157 und 158:
Kongresse • Tagungen • Symposie
- Seite 159 und 160:
Entwicklung eines Tissue Microarray
- Seite 161 und 162:
Mini-EBV-Vektoren für die Immunthe
- Seite 163 und 164:
Einfluss von Tumoren im Kopf-Hals-B
- Seite 165 und 166:
zellen in Azinuszellen stattfindet.
- Seite 167 und 168:
Rhinologie Plasmazytoide dendritisc
- Seite 169 und 170:
Gewebestreuung oder -reflexion bere
- Seite 171 und 172:
Tierexperimentelle Untersuchungen z
- Seite 173 und 174:
Auswertung der OSAS-Fragebögen und
- Seite 175 und 176:
gen peripheren Vestibulopathie unte
- Seite 177 und 178:
Publikationen (wissenschaftliche Or
- Seite 179 und 180:
27. Rotter N, Wagner H, Fuchshuber
- Seite 181 und 182:
13. Wiesmeth A, Wollenberg B (2003)
- Seite 183 und 184:
2.07 Klinik für Herzchirurgie Dire
- Seite 185 und 186:
poraler Zirkulation • Postoperati
- Seite 187 und 188:
Bearbeiter: Prof. Dr. N.W. Guldner,
- Seite 189 und 190:
Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Scharfsch
- Seite 191 und 192:
In-vitro Studien eines neuen Konzep
- Seite 193 und 194:
Bearbeiter: Dr. C. Schmidtke, Dipl.
- Seite 195 und 196:
Bearbeiter: Prof. Dr. H.H. Sievers,
- Seite 197 und 198:
Einzelvorhaben Der Krallenkonnektor
- Seite 199 und 200:
z.B. bei der Fallot'schen Tetralogi
- Seite 201 und 202:
Aorta ascendens und der Aortenbogen
- Seite 203 und 204:
capillary flow during retrograde ce
- Seite 205 und 206:
compartmental fluid volume shifts d
- Seite 207 und 208:
2.08 Klinik für Kiefer- und Gesich
- Seite 209 und 210:
immunhistochemisch, elektronenmikro
- Seite 211 und 212:
Evaluation der intraoperativen Angs
- Seite 213 und 214:
Kooperation: Dr. I. Lauer, Dr. R. N
- Seite 215 und 216:
15. Sieg P, Hakim SG, Bierwolf S, H
- Seite 217 und 218:
2.09 Klinik für Kinderchirurgie Di
- Seite 219 und 220:
Neben den notwendigen diagnostische
- Seite 221 und 222:
Frakturbehandlung • Tissue-Engine
- Seite 223 und 224:
Tierbissverletzungen im Kindesalter
- Seite 225 und 226:
Morbus Hirschsprung, Neuronale Dysp
- Seite 227 und 228:
Buch • Buchbeitrag • Übersicht
- Seite 229 und 230:
2.10 Klinik für Kinder- und Jugend
- Seite 231 und 232:
Krankenversorgung Die klinische Ver
- Seite 233 und 234:
der- und Jugendpsychosomatik (Frau
- Seite 235 und 236:
Kooperation: Dr. G. Stichtenoth, Pr
- Seite 237 und 238:
senken kann. Bearbeiter: Dr. S. Kö
- Seite 239 und 240:
einsetzt und ob diese Kinder ihr ge
- Seite 241 und 242:
patientenbezogene psychosoziale Bet
- Seite 243 und 244:
Immuntherapie EBV-assoziierter Erkr
- Seite 245 und 246:
Bearbeiter: PD Dr. C. Schultz, Prof
- Seite 247 und 248:
Forschungsschwerpunkt Pädiatrische
- Seite 249 und 250:
Charakterisierung von Makrophagen a
- Seite 251 und 252:
klinischer Forschung und epidemiolo
- Seite 253 und 254:
Schweden, J. Parkes, Queens Univers
- Seite 255 und 256:
trum für Reproduktionsmedizin und
- Seite 257 und 258:
DRG-Arbeitsgruppe: Analyse der Codi
- Seite 259 und 260:
tion. J Pediatr Endocrinol Metab 16
- Seite 261 und 262:
48. Strunk T, Gottschalk S, Göpel
- Seite 263 und 264:
07. Herting E (2004) Surfactantther
- Seite 265 und 266:
2.11 Hochschulambulanz für Kinder-
- Seite 267 und 268:
Einbeziehung neuester Forschungserg
- Seite 269 und 270:
Einzelvorhaben Leitlinien zu Diagno
- Seite 271 und 272:
Störungs- und Behandlungsverlauf b
- Seite 273 und 274:
Früherkennung und Frühinterventio
- Seite 275 und 276:
2.12 Medizinische Klinik I Direktor
- Seite 277 und 278:
sus für Injektionstechnik • Einf
- Seite 279 und 280:
Endokrinologie des Metabolischen Sy
- Seite 281 und 282:
Infektiologisch-nephrologische Unte
- Seite 283 und 284:
Beteiligte Einrichtungen: Medizinis
- Seite 285 und 286:
Teilprojekt 3: Kortikosteroid-Feedb
- Seite 287 und 288:
Energie bei Patienten mit schweren
- Seite 289 und 290:
RAA-System und die endokrine Stress
- Seite 291 und 292:
Doktorandin: B. Kempgens Kooperatio
- Seite 293 und 294:
Regulationsmechanismen endotheliale
- Seite 295 und 296:
Gastroenterologie Wiederholte doppl
- Seite 297 und 298:
hinderung von klinischen Rezidiven
- Seite 299 und 300:
Therapieoptimierungsstudie zur Wirk
- Seite 301 und 302:
Untersuchungen zur lokalen, extrahe
- Seite 303 und 304:
Bearbeiter: Dr. J. Kramer Nichtwiss
- Seite 305 und 306:
Kooperation: Dr. B. Weidtmann, Medi
- Seite 307 und 308:
05. Bauermeister KT, Stölting S, K
- Seite 309 und 310:
31. Jabs WJ, Sedlmeyer A, Ramassar
- Seite 311 und 312:
58. Müller-Steinhardt M, Fricke L,
- Seite 313 und 314:
Buch • Buchbeitrag • Übersicht
- Seite 315 und 316:
2.13 Medizinische Klinik II Direkto
- Seite 317 und 318:
gion sichergestellt ist. Beim akute
- Seite 319 und 320:
27.10.2004 Hotline Kardiologie, Mö
- Seite 321 und 322:
myokardprotektive adjuvante Maßnah
- Seite 323 und 324:
Einzelvorhaben Körperschemastörun
- Seite 325 und 326:
lokalisierte Stenosen eine hohe Her
- Seite 327 und 328:
geblich verantwortlich ist. Es werd
- Seite 329 und 330:
im Vergleich zu konventioneller Ant
- Seite 331 und 332:
Ventrikuläre Repolarisation und au
- Seite 333 und 334:
kardialen Druck- und Volumenbelastu
- Seite 335 und 336:
plötzlichen Herztod mit elektrophy
- Seite 337 und 338:
16. Chun JK, Bode F, Wiegand UK (20
- Seite 339 und 340:
train: a subgroup analysis from the
- Seite 341 und 342:
phosphatidylinositol 3-kinase/prote
- Seite 343 und 344:
2.14 Medizinische Klinik III Direkt
- Seite 345 und 346:
während der ambulant erworbener Pn
- Seite 347 und 348:
Nichtwiss. Mitarbeiterin: U. Wegene
- Seite 349 und 350:
failure associated with tenofovir t
- Seite 351 und 352:
2.15 Klinik für Neurochirurgie Dir
- Seite 353 und 354:
strukturen sowie in die Forschungss
- Seite 355 und 356:
Faktoren in Bezug auf die Regulatio
- Seite 357 und 358:
gestelltes modernes Operationsmikro
- Seite 359 und 360:
Prognostischer Wert von Serumprotei
- Seite 361 und 362:
Publikationen (wissenschaftliche Or
- Seite 363 und 364:
29. Gliemroth J, Klaus S, Bahlmann
- Seite 365 und 366:
2.16 Klinik für Neurologie Direkto
- Seite 367 und 368:
Shikata, Elisa, M.D., Stipendium de
- Seite 369 und 370:
Symposium auf der 76. Jahrestagung
- Seite 371 und 372:
Forschungsschwerpunkte Die Klinik f
- Seite 373 und 374:
plastischer Veränderungen durch ce
- Seite 375 und 376:
Fischer (Neuroendokrinologie), Dr.
- Seite 377 und 378:
In den vergangenen beiden Jahren wu
- Seite 379 und 380:
sind, das dopaminerge und serotonin
- Seite 381 und 382:
Kooperation: Dipl-Inf. C. Kier, Pro
- Seite 383 und 384:
Doktorand: S. Ohlendorf Förderung:
- Seite 385 und 386:
differenziert, die abhängig von de
- Seite 387 und 388:
häufigsten Mutationstypus im Parki
- Seite 389 und 390:
Neurobiochemie der Basalganglien AT
- Seite 391 und 392:
(Neurologie, Bochum), A. Herment (I
- Seite 393 und 394:
16. Horn AK, Helmchen C, Wahle P (2
- Seite 395 und 396:
44. Buccino G, Binkofski F, Riggio
- Seite 397 und 398:
71. Scholz J, Klingemann I, Moser A
- Seite 399 und 400:
Mamoli B (Hrsg) Landsberg am Lech:
- Seite 401 und 402:
2.17 Klinik für Orthopädie Kommis
- Seite 403 und 404:
Berufungen • Ehrungen • Mitglie
- Seite 405 und 406:
mechanische Klebewirkungen lückenh
- Seite 407 und 408:
die Last ermittelt, bei der die Fem
- Seite 409 und 410:
Biomechik von Knorpelersatzgewebe b
- Seite 411 und 412:
Nucleotomierate nach epiduraler Cor
- Seite 413 und 414:
2.18 Klinik für Plastische Chirurg
- Seite 415 und 416:
ehandlung von Schwerbrandverletzten
- Seite 417 und 418:
Forschungsschwerpunkte Mikrochirurg
- Seite 419 und 420:
Doktorand: T. Spanholtz Kooperation
- Seite 421 und 422:
Untersuchungen zum Einfluss von End
- Seite 423 und 424:
werden. Neben einem eigens entwicke
- Seite 425 und 426:
05. Machens HG, Salehi J, Weich H,
- Seite 427 und 428:
2.19 Klinik für Psychiatrie und Ps
- Seite 429 und 430:
krankungen, Entgiftung alkoholabhä
- Seite 431 und 432:
Moser unterzeichnet werden. Demnach
- Seite 433 und 434:
Fort- und Weiterbildung Die Weiterb
- Seite 435 und 436:
Psychiatria“ • Mitherausgeber d
- Seite 437 und 438:
jektiver und objektiver Einschränk
- Seite 439 und 440:
Zwangsstörung Die Erforschung der
- Seite 441 und 442:
Entwicklung eines interaktiven Intr
- Seite 443 und 444:
Bearbeiter: Dr. H.-J. Rumpf, Dipl.-
- Seite 445 und 446:
sucht und katamnestisch nachbefragt
- Seite 447 und 448:
Doktorand: N. Striegler Kooperation
- Seite 449 und 450:
Bearbeiter: Dr. K. Kahl, Prof. Dr.
- Seite 451 und 452:
Einfluss von chronisch gestörtem S
- Seite 453 und 454:
Schlafqualität als Prädiktor für
- Seite 455 und 456:
Neuropharmakologischer Funktionstes
- Seite 457 und 458:
parietale und/oder frontale Dysfunk
- Seite 459 und 460:
Performance Test) eingesetzt sowie
- Seite 461 und 462:
24. John U, Meyer C, Hapke U, Rumpf
- Seite 463 und 464:
51. Lencer R, Trillenberg P, Trille
- Seite 465 und 466:
78. Schumann A, Rumpf H-J, Meyer C,
- Seite 467 und 468:
16. Freyer J, Tonigan JS, John U, R
- Seite 469 und 470: 38. Rumpf H-J, Bischof G, Grothues
- Seite 471 und 472: 2.20 Poliklinik für Rheumatologie
- Seite 473 und 474: Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpo
- Seite 475 und 476: desweit einzigartiges Vaskulitisreg
- Seite 477 und 478: und Schmerz", und in den Beirat und
- Seite 479 und 480: Kooperation: Klinik für Dermatolog
- Seite 481 und 482: R. Küppers, I. Medizinische Klinik
- Seite 483 und 484: Nichtwiss. Mitarbeiterin: M. Backes
- Seite 485 und 486: 2004 18. Ahmadi-Simab K, Lamprecht
- Seite 487 und 488: 04. Gross WL (2003) Immunopathogene
- Seite 489 und 490: 16. Hellmich B, Csernok E, Gross WL
- Seite 491 und 492: 48. Hellmich B, Kausch I, Doehn C,
- Seite 493 und 494: 2.21 Klinik für Strahlentherapie u
- Seite 495 und 496: Bereich Nuklearmedizin • Molekula
- Seite 497 und 498: Die Klinik ist am POL-Unterricht un
- Seite 499 und 500: Bearbeiter: Dr. T. Meyners Doktoran
- Seite 501 und 502: 09. Rades D, Fehlauer F, Bajrovic A
- Seite 503 und 504: dass auch bei malignen Schilddrüse
- Seite 505 und 506: ihres Einflusses auf das weitere th
- Seite 507 und 508: Änderungen des Iod-Uptakes nach Ra
- Seite 509 und 510: [ 18 F]FDG, der 3-Phasen-Skelettszi
- Seite 511 und 512: 2.22 Klinik für Unfallchirurgie Di
- Seite 513 und 514: ativen Belastungen der Fußwurzelge
- Seite 515 und 516: 12. Gerlach UJ, Strametz S, Jürgen
- Seite 517 und 518: 2.23 Klinik für Urologie Direktor:
- Seite 519: Spezialsprechstunden werden für di
- Seite 523 und 524: Untersuchung zum Einsatz einer Dend
- Seite 525 und 526: 31. Menke T, Böttcher K, Krüger S
- Seite 527 und 528: 2.24 Lehrauftrag für Allgemeinmedi
- Seite 529 und 530: Buch • Buchbeitrag • Übersicht
- Seite 531 und 532: 3. Mit der Universität zu Lübeck
- Seite 533 und 534: 3.01 Forschungszentrum Borstel - Le
- Seite 535 und 536: 3.02 Medizinisch-Psychosomatische K
- Seite 537 und 538: 4. Habilitationen Diese Aufstellung
- Seite 539 und 540: 2004 Bahlmann, Ludger, Dr. med. Das
- Seite 541 und 542: Wenzl, Michael, Dr. med. Untersuchu
- Seite 543 und 544: 5. Dissertationen Diese Aufstellung
- Seite 545 und 546: Bopp, Christina Zur Entwicklung der
- Seite 547 und 548: Löning, Uta Fluoreszenzmikroskopis
- Seite 549 und 550: Kabelitz, Anja Molekulargenetische
- Seite 551 und 552: Radike, Kerstin, geb. Kistner Wirku
- Seite 553 und 554: 2.15 Klinik für Neurochirurgie Kle
- Seite 555 und 556: Lingnau, Anja Untersuchungen zur Ap
- Seite 557 und 558: Ihmann, Thomas Vergleich der pKi-67
- Seite 559 und 560: Bethge, Florian Lebensqualität nac
- Seite 561 und 562: Geißler, Carmen Die Bedeutung des
- Seite 563 und 564: Wiehl, Sandra Untersuchungen zur Wi
- Seite 565 und 566: Kann, Martin Klinisch-genetische Un
- Seite 567: Jeßen, Timo Vergleich der Wirksamk
- Seite 571:
6. Drittmittelübersicht der Univer



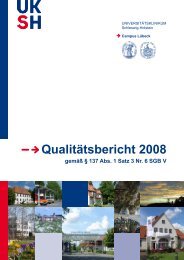



![Ausgabe Januar 2013 [pdf] - UKSH Universitätsklinikum Schleswig ...](https://img.yumpu.com/11131115/1/184x260/ausgabe-januar-2013-pdf-uksh-universitatsklinikum-schleswig-.jpg?quality=85)
![Qualitätsbericht 2011 Campus Kiel [PDF] - UKSH ...](https://img.yumpu.com/9884717/1/184x260/qualitatsbericht-2011-campus-kiel-pdf-uksh-.jpg?quality=85)
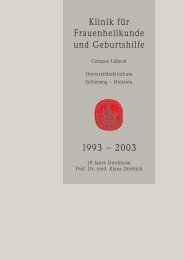

![Interdisziplinäres Symposium Inkontinenz am 24.9.08 [pdf] - UKSH ...](https://img.yumpu.com/7718861/1/190x135/interdisziplinares-symposium-inkontinenz-am-24908-pdf-uksh-.jpg?quality=85)