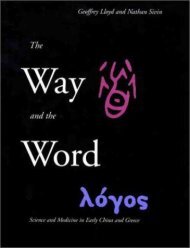- Seite 1 und 2:
Das Werk des Dichters Jiang Kui (ca
- Seite 3 und 4:
1. Verschiedene Motivation für den
- Seite 5 und 6:
Dichtungsgattungen nicht nur eine e
- Seite 7 und 8:
„Gedanken“ (yi) des Gedichtes z
- Seite 9 und 10:
Bedingungen einer dem Untergang gew
- Seite 11 und 12:
dem Titel „The Transformation of
- Seite 13 und 14:
lyrical self. (...) The important d
- Seite 15 und 16:
egreifbar zu machen. Die Untersuchu
- Seite 17 und 18:
sowie bestimmte Vorlieben für poet
- Seite 19 und 20:
Anders als bei Shuen-fu Lin oder Wa
- Seite 22 und 23:
Teil I 22
- Seite 24 und 25:
ausspähten, indirekt zu verstehen
- Seite 26 und 27:
karge Landschaft, deren Charakter a
- Seite 28 und 29:
Eine Ursache für die Erfolglosigke
- Seite 30 und 31:
in einer ähnlichen äußeren Lage
- Seite 32 und 33:
Steine und die Zeitgenossen nannten
- Seite 34 und 35:
in solchen vordergründigen Widersp
- Seite 36 und 37:
in diesem Zeitraum, aber auch verei
- Seite 38 und 39:
fanatische Attacken gegen die „Ke
- Seite 40 und 41:
zwischen 1195 und 1207 eine wichtig
- Seite 42 und 43:
das an die hundert Jahre währt, is
- Seite 44 und 45:
hochachtungsvoller Stellungnahmen z
- Seite 46 und 47:
unerwähnt bleibt aber die Rolle, d
- Seite 48 und 49: Später trat er zunächst als öffe
- Seite 50 und 51: dem Krieg hatte er mehrere hohe Pro
- Seite 52 und 53: vermag aber seine politische Bedeut
- Seite 54: Selbstwertgefühl in musischer und
- Seite 57 und 58: seiner Schrift „Über philologisc
- Seite 59 und 60: weitestgehenden Anforderungen an da
- Seite 61 und 62: Reiseerlebnisse deuten, sondern mit
- Seite 63 und 64: Desweiteren fällt auf, daß in den
- Seite 65 und 66: nur aus dem Bezug zu Li Bo, nicht a
- Seite 67 und 68: das den Text durch den Widerspruch
- Seite 69 und 70: analytisches Instrumentarium in die
- Seite 71 und 72: Die Abstraktion auf ein reines Meng
- Seite 73 und 74: und die darin enthaltene Zäsur kan
- Seite 75 und 76: sich - wird einmal von der bloßen
- Seite 77 und 78: Die Weiterführung dieser Beobachtu
- Seite 79 und 80: Liebesdichtung den ci, Freundschaft
- Seite 81 und 82: Eine ähnliche, im Kern der Aussage
- Seite 83 und 84: zusätzlich oder anders auch „är
- Seite 85 und 86: Es heißt, am Yangzi dauerts sechs
- Seite 87 und 88: Erst Fan Chengda habe einen Durchbr
- Seite 89 und 90: Doch die Auflösung im Schlußvers
- Seite 91 und 92: 264) dort Festungsanlagen errichtet
- Seite 93 und 94: Jiang Kui legt sich an keinem Punkt
- Seite 95 und 96: Alten, zu denen vorläufig nur ein
- Seite 97: Noch die Einteilung sämtlicher ci
- Seite 101 und 102: Jede Beurteilung von ci-Gedichten m
- Seite 103 und 104: daß wir es hier nicht nur mit eine
- Seite 105 und 106: Daß Li Yu in seinen späten ci daz
- Seite 107 und 108: Tiefe lebhaften Ausdrucks und der L
- Seite 109 und 110: Gehalt zu „härten“, ist es doc
- Seite 111 und 112: Auch ohne im einzelnen auf den Zusa
- Seite 113 und 114: ewegte, erscheint offensichtlich. E
- Seite 115 und 116: der metrisch „strengeren“ und
- Seite 117 und 118: Feldmarschall Huan (312-373) sprach
- Seite 119 und 120: Eigenarten von Jiang Kuis Kompositi
- Seite 121 und 122: spielen, auf Blasinstrumente zu üb
- Seite 123 und 124: evorzugte) spielbar. Der Schlußver
- Seite 125 und 126: Ein Vergleich beider Textarten zeig
- Seite 127 und 128: Am Tag der Wintersonnenwende des Ja
- Seite 129 und 130: auch emotional (...fand mich betrof
- Seite 131 und 132: Erwartung, daß nun der Dichter die
- Seite 133 und 134: 16 4 x x x x Das am häufigsten wie
- Seite 135 und 136: stille Hingabe eines gewissen Zeitg
- Seite 137 und 138: c) Schriften zur Dichtung La litté
- Seite 139 und 140: 1. Dichtung hat ursprünglich gar k
- Seite 141 und 142: 2. Beim Dichten mit den Alten über
- Seite 143 und 144: Demut und die Angst, selbst Fehler
- Seite 145 und 146: edeutet ursprünglich „Webstuhl
- Seite 147 und 148: Yang Wanli war nicht allein durch s
- Seite 149 und 150:
Diese Unterscheidung im Vorwort zu
- Seite 151 und 152:
Jiang Kui spricht zwar vom großen
- Seite 153 und 154:
Alle Dinge gleich betrachten: was i
- Seite 155 und 156:
Ohne die Krankheiten der Dichtung z
- Seite 157 und 158:
(yi), das ursprüngliche Stilideal
- Seite 159 und 160:
Meister Ji vom Südweiler saß, den
- Seite 161 und 162:
somit beinahe der Hinweis, daß die
- Seite 163 und 164:
Kein Bild könnte den Gedanken der
- Seite 165 und 166:
165
- Seite 167 und 168:
anerkannter Dichter in „Rechtglä
- Seite 169 und 170:
Yan Yu sagt: Gemeinhin liegt der We
- Seite 171 und 172:
Das schwer zu Sagende ist mit einem
- Seite 173 und 174:
handwerksmäßig arbeiten, während
- Seite 175 und 176:
Hinsicht, sondern durch die, von ih
- Seite 177 und 178:
Das selbständige Durchdenken eines
- Seite 179 und 180:
heißen, daß die Dichtung zwar Kö
- Seite 181 und 182:
Verses verlangt nach Klarheit, nach
- Seite 183 und 184:
Unendliches gegangen ist, die Grazi
- Seite 185 und 186:
sie gleich darauf wieder abstreifen
- Seite 187 und 188:
DRITTES KAPITEL: Der Rückzug in di
- Seite 189 und 190:
1. Gedichte im Alten Stil für Wang
- Seite 191 und 192:
Auch wenn die Wortwahl im Kontext d
- Seite 193 und 194:
On gouverne un pays par la rectific
- Seite 195 und 196:
Beschmutzung schmutzig. Mein einzig
- Seite 197 und 198:
Für tausend Stücke Gold hab’ ic
- Seite 199 und 200:
auf den Posten eines „Textrevisor
- Seite 201 und 202:
unter das Proskriptionsedikt gegen
- Seite 203 und 204:
Zirpen, wenn der Herbst kommt, klag
- Seite 205 und 206:
evorstehenden Trennung der freundsc
- Seite 207 und 208:
Trennungsgedichten der shi-Gattung,
- Seite 209 und 210:
andere überdachte Stätten. Die be
- Seite 211 und 212:
Abstandnehmen von der „Welt“. D
- Seite 213 und 214:
Wenn die Liebhaber aus den Bergen u
- Seite 215 und 216:
selbstbewußt behandeln, um sich ni
- Seite 217 und 218:
keine besonders beachtete Position
- Seite 219 und 220:
Es finden sich dort Vierzeiler-Zykl
- Seite 221 und 222:
Daraufhin machte jener das Lied vom
- Seite 223 und 224:
Dichtung und dem Prozeß des Dichte
- Seite 225 und 226:
DER SCHREIN DER DREI HOHEN 423 Als
- Seite 227 und 228:
Werken Jiang Kuis. Da die geistige
- Seite 229 und 230:
Durch die Syntax beider Verse im Ch
- Seite 231 und 232:
uns an den Pflaumenblüten beim Wes
- Seite 233 und 234:
Art, wie er die daraus resultierend
- Seite 235 und 236:
Liest man den Vers isoliert, so sch
- Seite 237 und 238:
abgeschlossen. Der Ausdruck drei Me
- Seite 239 und 240:
entspricht. Das direkte Gegenüber
- Seite 241 und 242:
Exposition des Themas ist gleich im
- Seite 243 und 244:
wie hier weckt es Erinnerung an Ver
- Seite 245 und 246:
im Alten Stil. Manchnmal möchte ic
- Seite 247 und 248:
gehen und sich im selben Moment dur
- Seite 249 und 250:
geographischer Plan, mit dem große
- Seite 251 und 252:
Aber wenn auch Jiang Kui persönlic
- Seite 253 und 254:
Gewaltiges Fünffarbenrad - Der Reg
- Seite 255 und 256:
zurück. In späteren Übernahmen d
- Seite 257 und 258:
Die Metaphorik der Verse 9 bis 14 v
- Seite 259 und 260:
Die eine Leibeshälfte lag noch auf
- Seite 261 und 262:
seien. 477 Die nähere Bestimmung a
- Seite 263 und 264:
Felsens lebten, zusammenkommen und
- Seite 265 und 266:
Liu gibt seiner Geschichte zum Absc
- Seite 267 und 268:
Von den Hong-鴻 und den Yan-Gänse
- Seite 269 und 270:
zieht. Außerdem war zu beobachten,
- Seite 271 und 272:
dem Dongtingsee, abzuweichen, auch
- Seite 273 und 274:
am Ziel der Pilgerfahrten genüge t
- Seite 275 und 276:
abgeschnittenes Tal mit menschliche
- Seite 277 und 278:
Ein alter Tempel liegt von hier im
- Seite 279 und 280:
Sinn und die Bedeutung einer höher
- Seite 281 und 282:
Dennoch findet im Schlußgedicht (1
- Seite 283 und 284:
Dominanz, worüber der Anfang diese
- Seite 285 und 286:
auf, mit der der Leser aus dem Vorw
- Seite 287 und 288:
dem Wanderer, sondern ein „wirkli
- Seite 289 und 290:
nur Yang ist, in der perspektivisch
- Seite 291 und 292:
während in Han Yus Text der Dialek
- Seite 293 und 294:
Wer auf unvorhersehbare Weise von D
- Seite 295 und 296:
Ernst und Zerstreuung gleichwelcher
- Seite 297 und 298:
machten wir Wegstation in Jinling.
- Seite 299 und 300:
Ausfahrten zu ihr unternahm und sie
- Seite 301 und 302:
Zukunft sich in einer einzigen Frag
- Seite 303 und 304:
Hinsichtlich des Verhältnisses von
- Seite 305 und 306:
daß durch diese Verschlüsselung d
- Seite 307 und 308:
Vergebens sehnen sich die alten Vä
- Seite 309 und 310:
des dichterischen Gedankens verbund
- Seite 311 und 312:
Strophe um eine kleine Terz über d
- Seite 313 und 314:
fließend aneinanderreihen, wird im
- Seite 315 und 316:
Subjektivität bestimmt, während d
- Seite 317 und 318:
symbolische Schlüsselposition für
- Seite 319 und 320:
Den Schnee abklopfend vom goldenen
- Seite 321 und 322:
folgenden uns zugeordnet werden mü
- Seite 323 und 324:
Stimmung, indem sich das immer noch
- Seite 325 und 326:
genannt. Diese Benennung sollte auf
- Seite 327 und 328:
Neutralität der Person lägen Vorz
- Seite 329 und 330:
seiner Dichtung, die sich, nachdem
- Seite 331 und 332:
“einige überraschend irrelevante
- Seite 333 und 334:
(Vers 4), Im Jadeantlitz verblaßt
- Seite 335 und 336:
Assoziationen wird, auf dem sich di
- Seite 337 und 338:
die Stadt in der Vorstellung des Di
- Seite 339 und 340:
läßt. 593 Was spricht aber nunmeh
- Seite 341 und 342:
Stadtmauern befördert. Das Morgenh
- Seite 343 und 344:
Erstarrend, wo Ich einst umgezogen.
- Seite 345 und 346:
edeuten, das sich durch das Vergehe
- Seite 347 und 348:
sehen?’ Und sie bog das Haupt nac
- Seite 349 und 350:
Nach der Zerstörung meines Hauses
- Seite 351 und 352:
ausgeführt worden war, in knappest
- Seite 353 und 354:
und 15 führen den Gedanken weiter
- Seite 355 und 356:
Einzelschicksal, dessen Wege doch s
- Seite 357 und 358:
Sonstige chinesischsprachige Litera
- Seite 359 und 360:
Yang, Guanqing; Ke ting lei gao; in
- Seite 361 und 362:
Goepper, Roger; Shu-P’u, Der Trak
- Seite 363 und 364:
Qiao, Weide; A Cool Approach to Ten