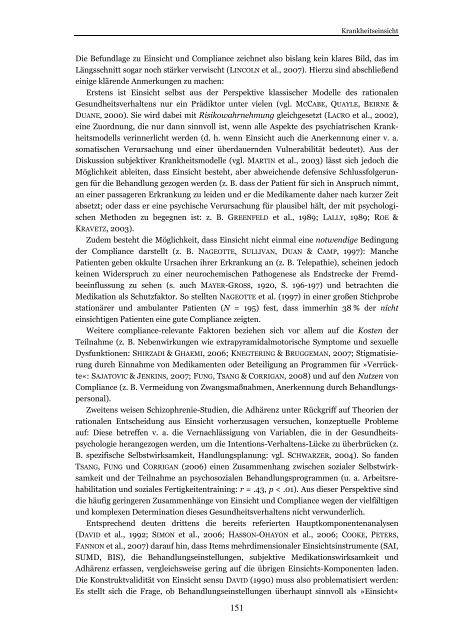Krankheitseinsicht, dynamisch getestete Exekutivfunktionen und ...
Krankheitseinsicht, dynamisch getestete Exekutivfunktionen und ...
Krankheitseinsicht, dynamisch getestete Exekutivfunktionen und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
151<br />
<strong>Krankheitseinsicht</strong><br />
Die Bef<strong>und</strong>lage zu Einsicht <strong>und</strong> Compliance zeichnet also bislang kein klares Bild, das im<br />
Längsschnitt sogar noch stärker verwischt (LINCOLN et al., 2007). Hierzu sind abschließend<br />
einige klärende Anmerkungen zu machen:<br />
Erstens ist Einsicht selbst aus der Perspektive klassischer Modelle des rationalen<br />
Ges<strong>und</strong>heitsverhaltens nur ein Prädiktor unter vielen (vgl. MCCABE, QUAYLE, BEIRNE &<br />
DUANE, 2000). Sie wird dabei mit Risikowahrnehmung gleichgesetzt (LACRO et al., 2002),<br />
eine Zuordnung, die nur dann sinnvoll ist, wenn alle Aspekte des psychiatrischen Krankheitsmodells<br />
verinnerlicht werden (d. h. wenn Einsicht auch die Anerkennung einer v. a.<br />
somatischen Verursachung <strong>und</strong> einer überdauernden Vulnerabilität bedeutet). Aus der<br />
Diskussion subjektiver Krankheitsmodelle (vgl. MARTIN et al., 2003) lässt sich jedoch die<br />
Möglichkeit ableiten, dass Einsicht besteht, aber abweichende defensive Schlussfolgerungen<br />
für die Behandlung gezogen werden (z. B. dass der Patient für sich in Anspruch nimmt,<br />
an einer passageren Erkrankung zu leiden <strong>und</strong> er die Medikamente daher nach kurzer Zeit<br />
absetzt; oder dass er eine psychische Verursachung für plausibel hält, der mit psychologischen<br />
Methoden zu begegnen ist: z. B. GREENFELD et al., 1989; LALLY, 1989; ROE &<br />
KRAVETZ, 2003).<br />
Zudem besteht die Möglichkeit, dass Einsicht nicht einmal eine notwendige Bedingung<br />
der Compliance darstellt (z. B. NAGEOTTE, SULLIVAN, DUAN & CAMP, 1997): Manche<br />
Patienten geben okkulte Ursachen ihrer Erkrankung an (z. B. Telepathie), scheinen jedoch<br />
keinen Widerspruch zu einer neurochemischen Pathogenese als Endstrecke der Fremdbeeinflussung<br />
zu sehen (s. auch MAYER-GROSS, 1920, S. 196-197) <strong>und</strong> betrachten die<br />
Medikation als Schutzfaktor. So stellten NAGEOTTE et al. (1997) in einer großen Stichprobe<br />
stationärer <strong>und</strong> ambulanter Patienten (N = 195) fest, dass immerhin 38 % der nicht<br />
einsichtigen Patienten eine gute Compliance zeigten.<br />
Weitere compliance-relevante Faktoren beziehen sich vor allem auf die Kosten der<br />
Teilnahme (z. B. Nebenwirkungen wie extrapyramidalmotorische Symptome <strong>und</strong> sexuelle<br />
Dysfunktionen: SHIRZADI & GHAEMI, 2006; KNEGTERING & BRUGGEMAN, 2007; Stigmatisierung<br />
durch Einnahme von Medikamenten oder Beteiligung an Programmen für »Verrückte«:<br />
SAJATOVIC & JENKINS, 2007; FUNG, TSANG & CORRIGAN, 2008) <strong>und</strong> auf den Nutzen von<br />
Compliance (z. B. Vermeidung von Zwangsmaßnahmen, Anerkennung durch Behandlungspersonal).<br />
Zweitens weisen Schizophrenie-Studien, die Adhärenz unter Rückgriff auf Theorien der<br />
rationalen Entscheidung aus Einsicht vorherzusagen versuchen, konzeptuelle Probleme<br />
auf: Diese betreffen v. a. die Vernachlässigung von Variablen, die in der Ges<strong>und</strong>heitspsychologie<br />
herangezogen werden, um die Intentions-Verhaltens-Lücke zu überbrücken (z.<br />
B. spezifische Selbstwirksamkeit, Handlungsplanung: vgl. SCHWARZER, 2004). So fanden<br />
TSANG, FUNG <strong>und</strong> CORRIGAN (2006) einen Zusammenhang zwischen sozialer Selbstwirksamkeit<br />
<strong>und</strong> der Teilnahme an psychosozialen Behandlungsprogrammen (u. a. Arbeitsrehabilitation<br />
<strong>und</strong> soziales Fertigkeitentraining: r = .43, p < .01). Aus dieser Perspektive sind<br />
die häufig geringeren Zusammenhänge von Einsicht <strong>und</strong> Compliance wegen der vielfältigen<br />
<strong>und</strong> komplexen Determination dieses Ges<strong>und</strong>heitsverhaltens nicht verw<strong>und</strong>erlich.<br />
Entsprechend deuten drittens die bereits referierten Hauptkomponentenanalysen<br />
(DAVID et al., 1992; SIMON et al., 2006; HASSON-OHAYON et al., 2006; COOKE, PETERS,<br />
FANNON et al., 2007) darauf hin, dass Items mehrdimensionaler Einsichtsinstrumente (SAI,<br />
SUMD, BIS), die Behandlungseinstellungen, subjektive Medikationswirksamkeit <strong>und</strong><br />
Adhärenz erfassen, vergleichsweise gering auf die übrigen Einsichts-Komponenten laden.<br />
Die Konstruktvalidität von Einsicht sensu DAVID (1990) muss also problematisiert werden:<br />
Es stellt sich die Frage, ob Behandlungseinstellungen überhaupt sinnvoll als »Einsicht«