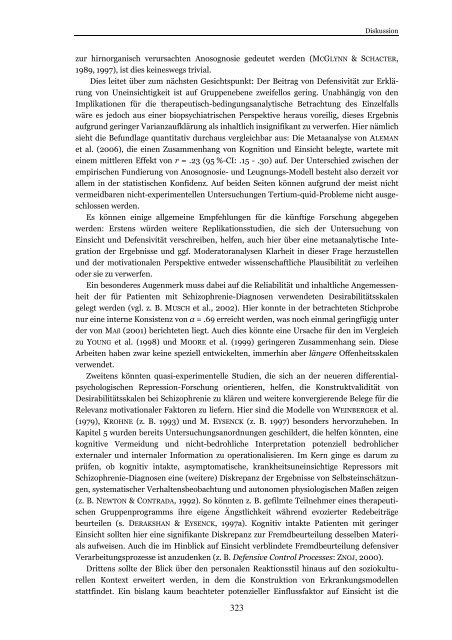Krankheitseinsicht, dynamisch getestete Exekutivfunktionen und ...
Krankheitseinsicht, dynamisch getestete Exekutivfunktionen und ...
Krankheitseinsicht, dynamisch getestete Exekutivfunktionen und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
323<br />
Diskussion<br />
zur hirnorganisch verursachten Anosognosie gedeutet werden (MCGLYNN & SCHACTER,<br />
1989, 1997), ist dies keineswegs trivial.<br />
Dies leitet über zum nächsten Gesichtspunkt: Der Beitrag von Defensivität zur Erklärung<br />
von Uneinsichtigkeit ist auf Gruppenebene zweifellos gering. Unabhängig von den<br />
Implikationen für die therapeutisch-bedingungsanalytische Betrachtung des Einzelfalls<br />
wäre es jedoch aus einer biopsychiatrischen Perspektive heraus voreilig, dieses Ergebnis<br />
aufgr<strong>und</strong> geringer Varianzaufklärung als inhaltlich insignifikant zu verwerfen. Hier nämlich<br />
sieht die Bef<strong>und</strong>lage quantitativ durchaus vergleichbar aus: Die Metaanalyse von ALEMAN<br />
et al. (2006), die einen Zusammenhang von Kognition <strong>und</strong> Einsicht belegte, wartete mit<br />
einem mittleren Effekt von r = .23 (95 %-CI: .15 - .30) auf. Der Unterschied zwischen der<br />
empirischen F<strong>und</strong>ierung von Anosognosie- <strong>und</strong> Leugnungs-Modell besteht also derzeit vor<br />
allem in der statistischen Konfidenz. Auf beiden Seiten können aufgr<strong>und</strong> der meist nicht<br />
vermeidbaren nicht-experimentellen Untersuchungen Tertium-quid-Probleme nicht ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Es können einige allgemeine Empfehlungen für die künftige Forschung abgegeben<br />
werden: Erstens würden weitere Replikationsstudien, die sich der Untersuchung von<br />
Einsicht <strong>und</strong> Defensivität verschreiben, helfen, auch hier über eine metaanalytische Integration<br />
der Ergebnisse <strong>und</strong> ggf. Moderatoranalysen Klarheit in dieser Frage herzustellen<br />
<strong>und</strong> der motivationalen Perspektive entweder wissenschaftliche Plausibilität zu verleihen<br />
oder sie zu verwerfen.<br />
Ein besonderes Augenmerk muss dabei auf die Reliabilität <strong>und</strong> inhaltliche Angemessenheit<br />
der für Patienten mit Schizophrenie-Diagnosen verwendeten Desirabilitätsskalen<br />
gelegt werden (vgl. z. B. MUSCH et al., 2002). Hier konnte in der betrachteten Stichprobe<br />
nur eine interne Konsistenz von α = .69 erreicht werden, was noch einmal geringfügig unter<br />
der von MAß (2001) berichteten liegt. Auch dies könnte eine Ursache für den im Vergleich<br />
zu YOUNG et al. (1998) <strong>und</strong> MOORE et al. (1999) geringeren Zusammenhang sein. Diese<br />
Arbeiten haben zwar keine speziell entwickelten, immerhin aber längere Offenheitsskalen<br />
verwendet.<br />
Zweitens könnten quasi-experimentelle Studien, die sich an der neueren differentialpsychologischen<br />
Repression-Forschung orientieren, helfen, die Konstruktvalidität von<br />
Desirabilitätsskalen bei Schizophrenie zu klären <strong>und</strong> weitere konvergierende Belege für die<br />
Relevanz motivationaler Faktoren zu liefern. Hier sind die Modelle von WEINBERGER et al.<br />
(1979), KROHNE (z. B. 1993) <strong>und</strong> M. EYSENCK (z. B. 1997) besonders hervorzuheben. In<br />
Kapitel 5 wurden bereits Untersuchungsanordnungen geschildert, die helfen könnten, eine<br />
kognitive Vermeidung <strong>und</strong> nicht-bedrohliche Interpretation potenziell bedrohlicher<br />
externaler <strong>und</strong> internaler Information zu operationalisieren. Im Kern ginge es darum zu<br />
prüfen, ob kognitiv intakte, asymptomatische, krankheitsuneinsichtige Repressors mit<br />
Schizophrenie-Diagnosen eine (weitere) Diskrepanz der Ergebnisse von Selbsteinschätzungen,<br />
systematischer Verhaltensbeobachtung <strong>und</strong> autonomen physiologischen Maßen zeigen<br />
(z. B. NEWTON & CONTRADA, 1992). So könnten z. B. gefilmte Teilnehmer eines therapeutischen<br />
Gruppenprogramms ihre eigene Ängstlichkeit während evozierter Redebeiträge<br />
beurteilen (s. DERAKSHAN & EYSENCK, 1997a). Kognitiv intakte Patienten mit geringer<br />
Einsicht sollten hier eine signifikante Diskrepanz zur Fremdbeurteilung desselben Materials<br />
aufweisen. Auch die im Hinblick auf Einsicht verblindete Fremdbeurteilung defensiver<br />
Verarbeitungsprozesse ist anzudenken (z. B. Defensive Control Processes: ZNOJ, 2000).<br />
Drittens sollte der Blick über den personalen Reaktionsstil hinaus auf den soziokulturellen<br />
Kontext erweitert werden, in dem die Konstruktion von Erkrankungsmodellen<br />
stattfindet. Ein bislang kaum beachteter potenzieller Einflussfaktor auf Einsicht ist die