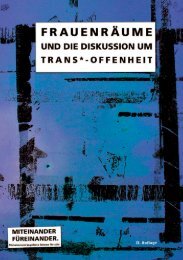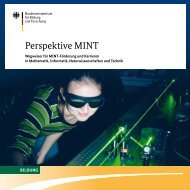- Seite 1 und 2:
Kinder-Migrationsreport Ein Daten-
- Seite 3 und 4:
Das Deutsche Jugendinstitut e.V. is
- Seite 5 und 6:
3.3.2 Nicht-institutionelle Betreuu
- Seite 8 und 9:
Vorwort Kinder und Migration - das
- Seite 10 und 11:
Einleitung Kindheitsforschung in De
- Seite 12 und 13:
miliales) Herkunftsland, Migrations
- Seite 14 und 15:
1.1 Die wichtigsten Ergebnisse Ein
- Seite 16 und 17:
Abbildung 2: 0- bis 14-jährige Kin
- Seite 18 und 19:
Kinder ausländischer Staatsangehö
- Seite 20 und 21:
Die Vielschichtigkeit des Begriffs
- Seite 22 und 23:
2 Kinder mit Migrationshintergrund
- Seite 24 und 25:
Im Familienalltag von unter 9-Jähr
- Seite 26 und 27:
Studien Stichprobe (n, Altersgruppe
- Seite 28 und 29:
Jeder dieser Abschnitte schließt m
- Seite 30 und 31:
) Geschwister Das im öffentlichen
- Seite 32 und 33:
sondere eine länger anhaltende Arb
- Seite 34 und 35:
gruppe der 6- bis 9-Jährigen, wäh
- Seite 36 und 37:
Abbildung 11: 0- bis 14-jährige Ki
- Seite 38 und 39:
Abbildung 13: 0- bis 14-jährige Ki
- Seite 40 und 41:
Abbildung 15: 0- bis 14-jährige Ki
- Seite 42 und 43:
Personen mit Migrationshintergrund,
- Seite 44 und 45:
Die separaten regressionsanalytisch
- Seite 46 und 47:
Abbildung 17: 0- bis 14-jährige Ki
- Seite 48 und 49:
einseitigem Migrationshintergrund i
- Seite 50 und 51:
Abbildung 22: 0- bis 14-jährige Ki
- Seite 52 und 53:
Abbildung 23: 0- bis 14-jährige Ki
- Seite 54 und 55:
Abbildung 26: 0- bis 14-jährige Ki
- Seite 56 und 57:
für Kinder ein etwa doppelt so hoh
- Seite 58 und 59:
Abbildung 29: 0- bis 14-jährige Ki
- Seite 60 und 61:
die Hälfte der Jungen und Mädchen
- Seite 62 und 63:
ehemaligen Anwerbestaaten sind zu u
- Seite 64 und 65:
Ähnlich fallen die Relationen hins
- Seite 66 und 67:
in der Gruppe der Kinder mit einem
- Seite 68 und 69:
Beteiligung an der Hausarbeit einge
- Seite 70 und 71:
Abbildung 37: Von 6- bis 8-jährige
- Seite 72 und 73:
Sowohl hinsichtlich des Ausübens d
- Seite 74 und 75:
Einblick in einen spezifischen Bere
- Seite 76 und 77:
Abbildung 43: Häufig in außerhäu
- Seite 78 und 79:
tive Effekte ergeben sich aus einem
- Seite 80 und 81:
Abbildung 46: Kinder mit und ohne M
- Seite 82 und 83:
der Fall ist. Generell lässt sich
- Seite 84 und 85:
ist in der Gruppe der Eltern mit t
- Seite 86 und 87:
Auch unter einer nach nationaler Fa
- Seite 88 und 89:
Fragen nach dem „gemeinsamen Lese
- Seite 90 und 91:
Abbildung 58: Häufigkeit des elter
- Seite 92 und 93:
Geschlechterunterschiede in den Bew
- Seite 94 und 95:
Abbildung 61: Durch Kinder mit Migr
- Seite 96 und 97:
Tabelle 3: Bewertung der Beziehung
- Seite 98 und 99:
der niedrigeren Schichten im Vergle
- Seite 100 und 101:
Analysen der Daten des LBS-Kinderba
- Seite 102 und 103:
Deutsch mit den Eltern (74%). 79 Le
- Seite 104 und 105:
Geschlechterunterunterschiede im ge
- Seite 106 und 107:
2. Kinder mit Migrationshintergrund
- Seite 108 und 109:
die Beziehungsqualität in Familien
- Seite 110 und 111:
9. Von kulturellen bzw. sozialen Ri
- Seite 112 und 113:
knüpft werden können - etwas häu
- Seite 114 und 115:
15. Die Mehrheit der 6- bis 8-jähr
- Seite 116 und 117:
Konflikt-Hypothese, die davon ausge
- Seite 118 und 119:
2. Die amtliche Repräsentativstati
- Seite 120 und 121:
mit allgemeineren, familialen Merkm
- Seite 122 und 123:
3.1 Die wichtigsten Ergebnisse Von
- Seite 124 und 125:
3.2 Datenquellen Tabelle 4: Verwend
- Seite 126 und 127:
3.3 Befunde Öffentliche Bildung, B
- Seite 128 und 129:
Abbildung 71: Betreuungsquoten für
- Seite 130 und 131:
) Betreuungsquoten auf Bundeslände
- Seite 132 und 133:
eide Gruppen fast identische Anteil
- Seite 134 und 135:
Abbildung 75: Familiäre Sprachprax
- Seite 136 und 137:
nicht-deutscher Familiensprache zwi
- Seite 138 und 139:
sind häufig sozial benachteiligte
- Seite 140 und 141:
Abbildung 79: Kinder mit und ohne M
- Seite 142 und 143:
Abbildung 81: 0- bis 6-jährige Kin
- Seite 144 und 145:
ung verweist darauf, dass die Kinde
- Seite 146 und 147: c) Gemischte Betreuungsformen Neben
- Seite 148 und 149: lerkindern drei Mal so häufig wie
- Seite 150 und 151: Abbildung 88: Kinder mit und ohne M
- Seite 152 und 153: stufen am seltensten Betreuungsform
- Seite 154 und 155: einer Familie ohne Migrationshinter
- Seite 156 und 157: Die Teilnahme an einer institutione
- Seite 158 und 159: dition ab, die auf die ehemalige DD
- Seite 160 und 161: 6. Faktoren, die die Nutzung der in
- Seite 162 und 163: Gruppe der „Minderheiten“, also
- Seite 164 und 165: In diesem Kontext kann nur spekulie
- Seite 166 und 167: 4.1 Die wichtigsten Ergebnisse Mehr
- Seite 168 und 169: Die meisten Kinder mit Migrationshi
- Seite 170 und 171: Studien ÜBERGANG TIMSS-Übergangss
- Seite 172 und 173: Studien DJI-Survey „Aufwachsen in
- Seite 174 und 175: 4.3 Befunde Im ersten Abschnitt die
- Seite 176 und 177: Abbildung 93: Anteil 3- bis 7-jähr
- Seite 178 und 179: Abbildung 94: Vorzeitige und versp
- Seite 180 und 181: Wurden zusätzlich der Zeitpunkt de
- Seite 182 und 183: mit Migrationshintergrund im Unterr
- Seite 184 und 185: en Auskunft darüber, ob und in wel
- Seite 186 und 187: Abbildung 102: Bewertung von Anford
- Seite 188 und 189: sich Eltern mit und ohne Migrations
- Seite 190 und 191: gung des Migrationshintergrundes be
- Seite 192 und 193: Gresch u.a. 2012, S. 63). Einflüss
- Seite 194 und 195: Schüler/innen mit Migrationshinter
- Seite 198 und 199: aussetzungen fehlen, dass mögliche
- Seite 200 und 201: 4.3.4.1 Stand und Entwicklung des G
- Seite 202 und 203: Abbildung 111: Zeitliche Entwicklun
- Seite 204 und 205: d) Sekundarstufe I Für Schüler/in
- Seite 206 und 207: positive Effekte der Beziehungsqual
- Seite 208 und 209: Mutter wird in 10 bis 11% der Fäll
- Seite 210 und 211: Kinder ohne Migrationshintergrund u
- Seite 212 und 213: nichts hilft“, dass sie das Inter
- Seite 214 und 215: Abbildung 117: Einschätzung des sc
- Seite 216 und 217: Weniger als ein Fünftel der Kinder
- Seite 218 und 219: Abbildung 120: Relation der Schulki
- Seite 220 und 221: Abbildung 121: Motive der Eltern f
- Seite 222 und 223: ejahen. Wenn sich aber einerseits e
- Seite 224 und 225: 10. Trotz ihrer positiven Einstellu
- Seite 226 und 227: 4. Es liegen keine aggregierten sta
- Seite 228 und 229: 2. Repräsentative Längsschnittstu
- Seite 230 und 231: 5 Kinderleben außerhalb von Famili
- Seite 232 und 233: Die Interpretation der Forschungser
- Seite 234 und 235: Studien „Ganztagsschule und Integ
- Seite 236 und 237: 5.3 Befunde Ergebnisse zum Kinderle
- Seite 238 und 239: denen ein Elternteil zugewandert is
- Seite 240 und 241: hier der Anteil von Kindern aus nie
- Seite 242 und 243: (48% zu 60%) und einen höheren bei
- Seite 244 und 245: Abbildung 126: Freizeitaktivitäten
- Seite 246 und 247:
Abbildung 127: Häufig ausgeübte F
- Seite 248 und 249:
is 25-Jährigen nach den individuel
- Seite 250 und 251:
Mobiltelefons, der Spielkonsole und
- Seite 252 und 253:
Die in der Altersgruppe der 13- und
- Seite 254 und 255:
Abbildung 132: Allein durchgeführt
- Seite 256 und 257:
Definition des Migrationshintergrun
- Seite 258 und 259:
Wird die Einbindung von Kindern mit
- Seite 260 und 261:
Abbildung 137: Häufigste Vereins-/
- Seite 262 und 263:
Abbildung 139: Beratende/unterstüt
- Seite 264 und 265:
Abbildung 141: Durchschnittliche Za
- Seite 266 und 267:
Abbildung 142: Anteil deutscher Fre
- Seite 268 und 269:
„mehrere“ Kinder oder „eines
- Seite 270 und 271:
grund haben. Von den Kindern mit t
- Seite 272 und 273:
) 13- bis 14-Jährige 13- bis 14-J
- Seite 274 und 275:
von geringeren Anteilen in der 1. u
- Seite 276 und 277:
die Einbindung von Eltern in intere
- Seite 278 und 279:
den demnach genauso intensiv gepfle
- Seite 280 und 281:
oder Malen, zusätzlich bei den Jü
- Seite 282 und 283:
8. Die Schule ist für Kinder mit -
- Seite 284 und 285:
ten Einblick in deren Lebenssituati
- Seite 286 und 287:
lungen, Lebenslagen und Alltagskult
- Seite 288 und 289:
und Betreuung im Elementarbereich b
- Seite 290 und 291:
wie dies bei Kindern ohne Migration
- Seite 292 und 293:
wusst und eigenverantwortlich zu me
- Seite 294 und 295:
Aus Angaben zur schulischen Befindl
- Seite 296 und 297:
kunftsland: Sowohl die Erwerbstäti
- Seite 298 und 299:
Kindern ohne Migrationshintergrund,
- Seite 300 und 301:
6.2.4 Geschlechtsspezifische Unters
- Seite 302 und 303:
und Jungen mit Migrationshintergrun
- Seite 304 und 305:
werklich und eignen sich stärker K
- Seite 306 und 307:
Literatur Alt, Christian (Hrsg.) (2
- Seite 308 und 309:
Bos, Wilfried/Hornberg, Sabine/Arno
- Seite 310 und 311:
Fuchs-Rechlin, Kirsten (2007): Kind
- Seite 312 und 313:
Krinninger, Dominik/Müller, Hans-R
- Seite 314 und 315:
Reinders, Heinz/Mangold, Tanja (200
- Seite 316 und 317:
Stürzer, Monika (2012): Allgemeinb
- Seite 318 und 319:
Verzeichnis der Tabellen und Abbild
- Seite 320 und 321:
Abbildung 25: 0- bis 14-jährige Ki
- Seite 322 und 323:
Abbildung 57: Elternunterstütztes
- Seite 324 und 325:
Abbildung 90: 0- bis 6-jährige Kin
- Seite 326 und 327:
Abbildung 125: Freizeitaktivitäten
- Seite 328 und 329:
Anhang I. Tabellen und Abbildungen
- Seite 330 und 331:
Tabelle A-5.6: Häufig ausgeübte F
- Seite 332 und 333:
Abbildung A-3.1: Betreuungsquoten f
- Seite 334 und 335:
Freunden mit Migrationshintergrund
- Seite 336 und 337:
Tabelle A-2.2: Effekte auf Armutsbe
- Seite 338 und 339:
Tabelle A-2.4: Effekte auf Erwerbst
- Seite 340 und 341:
Tabelle A-2.6: Effekte auf Armutsbe
- Seite 342 und 343:
Tabelle A-2.9: Effekte auf Armutsbe
- Seite 344 und 345:
Tabelle A-2.11: Effekte auf Armutsb
- Seite 346 und 347:
Tabelle A-2.13: Effekte auf Armutsb
- Seite 348 und 349:
Tabelle A-2.15: Häufig in familiä
- Seite 350 und 351:
Tabelle A-2.19: Sprache 0- bis 8-j
- Seite 352 und 353:
Tabelle A-3.2: Beitragsfreiheit fü
- Seite 354 und 355:
Tabelle A-5.4: Häufig ausgeübte F
- Seite 356 und 357:
Tabelle A-5.8: Allein durchgeführt
- Seite 358 und 359:
C. Abbildungsanhang Abbildung A-2.1
- Seite 360 und 361:
Abbildung A-2.4: Von 0- bis 8-jähr
- Seite 362 und 363:
Abbildung A-2.8: Häufig in außerh
- Seite 364 und 365:
Abbildung A-2.12: 0- bis 8-jährige
- Seite 366 und 367:
Abbildung A-2.16: Das Familienklima
- Seite 368 und 369:
Abbildung A-2.20: Die Beziehung zu
- Seite 370 und 371:
Abbildung A-3.2: Vertraglich verein
- Seite 372 und 373:
Abbildung A-3.5: Kinder mit Migrati
- Seite 374 und 375:
Abbildung A-3.8: 0- bis 14-jährige
- Seite 376 und 377:
Abbildung A-4.4: Gründe für gerin
- Seite 378 und 379:
Abbildung A-4.7: 9- bis 12-Jährige
- Seite 380 und 381:
Abbildung A-4.11: 9- bis 12-Jährig
- Seite 382 und 383:
Abbildung A-5.3: Vereins-/Gruppenak
- Seite 384 und 385:
Abbildung A-5.6: Durchschnittliche
- Seite 386 und 387:
Abbildung A-5.10: 6- bis 11-jährig
- Seite 388 und 389:
II. Glossar Arbeitslosengeld II „
- Seite 390 und 391:
gearbeitet haben, weil sie z.B. Url
- Seite 392 und 393:
trachten“ (Baumert/Schümer 2001,
- Seite 394 und 395:
Cotent/Statistiken/Sozialleistungen
- Seite 396 und 397:
Sozio-oekonomisches Panel (SOEP)
- Seite 398 und 399:
III. Abkürzungsverzeichnis AID:A