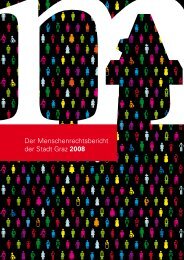MENSCHENRECHTE VERSTEHEN - ETC Graz
MENSCHENRECHTE VERSTEHEN - ETC Graz
MENSCHENRECHTE VERSTEHEN - ETC Graz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
tureller Prismen. So sind zum Beispiel körperliche<br />
Strafen wie das Zufügen von Schmerzen<br />
durch Stock oder Peitsche eine weit verbreitete<br />
Form von Misshandlung im Sinne einer<br />
korrektiven Maßnahme. Innerhalb der islamischen<br />
Scharia-Rechtstradition sind körperliche<br />
Strafen und sogar Amputationen<br />
nicht nur akzeptierte Praxis, sondern durch<br />
eine Anzahl von religiösen Gerichten, die<br />
Ehe- und Erbschaftsangelegenheiten sowie<br />
andere Bereiche des physischen und spirituellen<br />
Lebens von Moslems regeln, gesetzlich<br />
erlaubt. So werden zum Beispiel im Strafgesetzbuch<br />
der Provinz Zamfara in Nigeria<br />
(vom Jänner 2000), das auf den Grundsätzen<br />
der Scharia beruht, Stockschläge, Amputation<br />
und Todesstrafe als vom Gesetz zugelassene<br />
Bestrafungen beschrieben. Auch die Gerichtsentscheidungen<br />
der religiösen Gerichtshöfe in<br />
Saudiarabien, im Iran, in Libyen und in Afghanistan<br />
beruhen auf der Scharia.<br />
Die israelischen Sicherheitskräfte wurden<br />
zum Beispiel bereits wiederholt für ihren<br />
Gebrauch von mäßiger körperlicher Gewalt<br />
bei Befragungen kritisiert. Die Annahme der<br />
Vorschläge der Landau-Untersuchungskommission<br />
aus dem Jahre 1987, denen zu Folge<br />
der Gebrauch einer mäßigen Anwendung von<br />
körperlicher Gewalt während einer Befragung<br />
auf Basis der gegebenen Notwendigkeiten<br />
als gerechtfertigt angesehen wird, hat hitzige<br />
Debatten hervorgerufen. Bedenklich war vor<br />
allem, dass der Empfehlung keinerlei Klarstellungen<br />
hinsichtlich des Limits von mäßiger<br />
körperlicher Gewalt und des Beginns von Folter<br />
folgten. Einzig im Fall Public Committee<br />
against Torture in Israel vs. the State of Israel<br />
entschied der oberste Gerichtshof Israels,<br />
dass die Verwendung von mäßiger körperlicher<br />
Gewalt illegal sei, da sie den verfassungsgesetzlich<br />
gewährleisteten Schutz des Rechtes<br />
auf Würde des Einzelnen verletze. Tatsächlich<br />
betont das UNo-Antifolterkomitee in seinem<br />
Schlusswort und in den Empfehlungen zu Is-<br />
VERBoT DER FoLTER<br />
rael vom 23. November 2001, „… dass das<br />
Komitee keinesfalls überzeugt ist und seine<br />
Besorgnis darüber ausdrücken möchte, dass<br />
Folter, wie im Übereinkommen definiert, noch<br />
nicht als Verbotstatbestand in die nationale<br />
Rechtsordnung übernommen wurde“.<br />
Die beiden Beispiele zeigen, dass, obwohl die<br />
Standards für das Verbot von Folter international<br />
anerkannt sind, die tatsächliche Interpretation<br />
und die Implementierung von Land zu<br />
Land variieren können. Es ist jedenfalls eine<br />
offene Frage, inwieweit diese Auffassungsunterschiede<br />
das absolute und universelle Verbot<br />
von Folter in einem kulturell sensitiven<br />
Kontext bekräftigen, oder inwieweit sie den<br />
Zielen und dem Geist des völkerrechtlichen<br />
Gewohnheitsrechts wie auch des Völkervertragsrechts<br />
widersprechen.<br />
Eine Anzahl von strittigen Fragen und Antworten<br />
kann in diesem Zusammenhang<br />
ebenfalls erhoben werden. Im Moment wird,<br />
vor allem in den USA, eine hitzige Debatte<br />
darüber geführt, ob Terrorismus sich von<br />
anderen Formen der Menschenrechtsverletzungen<br />
und Verbrechen unterscheidet und<br />
ob demzufolge zusätzliche Standards geschaffen<br />
werden müssen, um Terrorismus<br />
zu verhindern und zu bekämpfen. Einige wenige<br />
Länder wie Irland, die Türkei und die<br />
USA haben Anti-Terror-Gesetze eingeführt,<br />
die ein, verglichen mit der üblichen nationalen<br />
Strafverfolgung, beschleunigtes Verfahren<br />
ermöglichen, mit der Konsequenz, dass<br />
Menschenrechte und Grundfreiheiten beschnitten<br />
werden. Nach den Ereignissen des<br />
11. September 2001 konnte man ein Wiederaufleben<br />
der uralten Debatte beobachten, ob<br />
es akzeptabel sei, TerroristInnen zu foltern,<br />
um das Leben anderer zu schützen. In engem<br />
Zusammenhang damit steht die Frage,<br />
ob opfer von Folter einen höheren Anspruch<br />
auf Schutz ihrer Menschenrechte haben als<br />
Kriminelle, und ob das Leben eines Verbrechers<br />
oder einer Terroristin gleich viel wert<br />
79