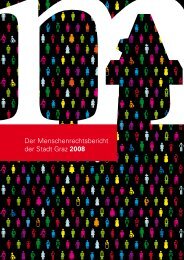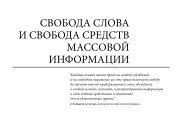MENSCHENRECHTE VERSTEHEN - ETC Graz
MENSCHENRECHTE VERSTEHEN - ETC Graz
MENSCHENRECHTE VERSTEHEN - ETC Graz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
156 RECHT AUF GESUNDHEIT<br />
delsorganisation (WTo) stimmte während der<br />
Ministerkonferenz in Doha 2001 zu, dass der<br />
Schutz solcher Patente „so interpretiert und<br />
implementiert werden sollte, dass das Recht<br />
der WTO-Mitglieder, die öffentliche Gesundheit<br />
zu schützen und im besonderen den Zugang<br />
aller zu Medikamenten zu fördern, unterstützt<br />
wird“. Im Speziellen bezog sich die Konferenz<br />
dabei auf das Recht jedes Staates, „festzulegen,<br />
was einen nationalen Notstand oder andere<br />
Umstände extremer Dringlichkeit konstituiert<br />
[die Ausnahmen vom Patentschutz erlauben],<br />
dies unter der Voraussetzung, dass Krisen des<br />
öffentlichen Gesundheitswesens einschließlich<br />
jener aufgrund von HIV/AIDS, Tuberkulose,<br />
Malaria und anderen Epidemien einen nationalen<br />
Notstand oder anderen Umstand extremer<br />
Dringlichkeit darstellen.“<br />
(Quelle: WTO. 2001. Doha Declaration on the<br />
TRIPS Agreement and Public Health.)<br />
Globalisierung und das Menschenrecht<br />
auf Gesundheit<br />
Seit den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts<br />
hat sich die Weltwirtschaft aufgrund der Globalisierung<br />
dramatisch verändert, was direkte<br />
und indirekte Auswirkungen auf die Gesundheit<br />
zeitigt. Positive Veränderungen sind<br />
beispielsweise ein Anstieg bei den Beschäftigungsmöglichkeiten,<br />
die Verbreitung wissenschaftlicher<br />
Erkenntnisse und eine größere<br />
Chance auf hohe Gesundheitsstandards weltweit,<br />
ermöglicht durch Kooperationen von Regierungen,<br />
Zivilgesellschaft und Unternehmen.<br />
Allerdings wiegen auch die negativen Konsequenzen<br />
schwer, da Liberalisierung des Handels,<br />
Investitionen in Ländern mit niedrigem<br />
arbeitsrechtlichen Standard und weltweite<br />
Vermarktung neuer Produkte in einigen Fällen,<br />
aufgrund von Versagen der Regierungen oder<br />
nicht ausreichender Regulierung, Ungleichheiten<br />
zwischen Ländern und innerhalb dieser<br />
geschaffen und so negative Einflüsse auf<br />
die Gesundheit mit sich gebracht haben. Die<br />
Fähigkeit von Regierungen, mögliche negative<br />
Konsequenzen des steigenden Flusses von<br />
Waren, Geld und Dienstleistungen sowie der<br />
Mobilität von Menschen, Kultur und Wissen<br />
über nationale Grenzen hinweg zu begrenzen,<br />
konnte nicht mit dieser Entwicklung Schritt<br />
halten. Gleichzeitig konnten sich multinationale<br />
Unternehmen ihrer Verantwortlichkeit<br />
entledigen. Die Task Force Gesundheitsökonomie<br />
der Weltgesundheitsorganisation etwa<br />
kritisiert, dass schädliche Substanzen wie Tabak<br />
nach wie vor ohne entsprechenden Gesundheitsschutz<br />
für die Bevölkerungen frei<br />
gehandelt werden.<br />
Handelsgesetze und deren Praxis mit der Menschenrechtsgesetzgebung<br />
zu konfrontieren, war<br />
weitgehend von der Sorge um das Recht auf<br />
Gesundheit motiviert. Ein Beispiel, dass das<br />
Bewusstsein für die Notwendigkeit von Regulierung<br />
gestiegen ist, zeigt sich bei den pharmazeutischen<br />
Lizenzen. In der oben genannten<br />
Deklaration von Doha (2001) etwa akzeptierten<br />
die Mitglieder der WTo, dass Regierungen in<br />
Notfällen verpflichtende Lizenzen zur Herstellung<br />
von Medikamenten erteilen können (Art. 5),<br />
dass Länder ohne pharmazeutische Kapazitäten<br />
Hilfe bei der Beschaffung von Medikamenten<br />
erhalten sollten (Art. 6), und dass die Industriestaaten<br />
die Entwicklungsländer beim Transfer<br />
von Technologien und Wissen auf dem Gebiet<br />
der Pharmazeutika unterstützen sollten (Art.<br />
7). Eine Entscheidung des WTo General Council<br />
vom August 2003 (2005 ersetzt durch eine<br />
Ergänzung des TRIPS-Abkommens) ermöglicht<br />
es Staaten, zwangsweise Lizenzen für die Produktion<br />
von patentgeschützten Medikamenten<br />
zu erteilen, die in weniger entwickelte Länder<br />
exportiert werden, die ihrerseits nicht über die<br />
Möglichkeit zur Produktion solcher Medikamente<br />
verfügen. Damit werden die Bedürfnisse des<br />
öffentlichen Gesundheitswesens über die Rechte<br />
der Patentnehmer gestellt. Zugleich erlauben<br />
allerdings die Regeln des TRIPS-Abkommens<br />
wiederum den Abschluss multi- oder bilateraler