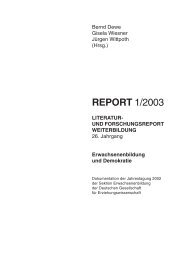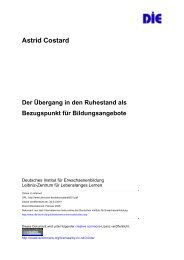- Seite 1 und 2:
Reinhard Mussik Möglichkeiten und
- Seite 3 und 4:
Möglichkeiten und Grenzen der Inte
- Seite 5 und 6:
Zusammenfassung In dieser Arbeit wi
- Seite 7 und 8:
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 11
- Seite 9 und 10:
6.1.2 Besonderheiten der IF-Wochens
- Seite 11 und 12:
Abkürzungsverzeichnis BtM Betäubu
- Seite 13 und 14:
1 Einleitung 1.1 Problemlage Die No
- Seite 15 und 16:
- eine Erhöhung der Effektivität
- Seite 17 und 18:
der konstruktivistischen Lerntheori
- Seite 19 und 20:
1.3 Wissenschaftliche Fragestellung
- Seite 21 und 22:
ge der Polizei zu polizeikritischen
- Seite 23 und 24:
ungen dargelegt werden, die bei der
- Seite 25 und 26:
2002, Schneider 2000, Winter 1998).
- Seite 27 und 28:
dieses Prozesses, der einem externe
- Seite 29 und 30:
lizei eintretenden Polizisten wurde
- Seite 31 und 32:
Dutzend von Großeinsätzen mit meh
- Seite 33 und 34:
den sollten. Trotzdem gab es in die
- Seite 35 und 36:
ten erfolgte also immer nur in Folg
- Seite 37 und 38:
des Polizeibeamten in Frage zu stel
- Seite 39 und 40:
Organisations- und Führungsstruktu
- Seite 41 und 42:
Rechtsverhältnisse mit einer verä
- Seite 43 und 44:
oder der Forschungsbericht von Wand
- Seite 45 und 46:
nen Item ließen auf einen deutlich
- Seite 47 und 48:
im Mittelpunkt der polizeilichen Di
- Seite 49 und 50:
führung von Managementtechniken au
- Seite 51 und 52:
eruht. (Savelsberg 1995, S. 9) Sein
- Seite 53 und 54:
- Personal- und Sachhaushalt sollte
- Seite 55 und 56:
Vor der Reform war die Integrierte
- Seite 57 und 58:
worden. Es besteht vielmehr der Ein
- Seite 59 und 60:
ungen und klare Verantwortlichkeite
- Seite 61 und 62:
Beginn des Reformprozesses nicht un
- Seite 63 und 64:
einem schlechten Betriebsklima füh
- Seite 65 und 66:
egann man in der Bundesrepublik Deu
- Seite 67 und 68:
dung der Polizei ergeben, werden vo
- Seite 69 und 70:
Der Begriff „Organisation“ hat
- Seite 71 und 72:
len oder ideellen Input handelt. Be
- Seite 73 und 74:
schaftlichen Handelns, als auch die
- Seite 75 und 76:
Dies kann im betriebswirtschaftlich
- Seite 77 und 78:
herrschenden Werte bestimmen letzte
- Seite 79 und 80:
94) Auch hier muss man aber wieder
- Seite 81 und 82:
tensregulierung nötig ist, gilt ab
- Seite 83 und 84:
dann lassen sich folgende Aussage f
- Seite 85 und 86:
sungen übernommen und tragen auf D
- Seite 87 und 88:
Kundenorientierung, Mitarbeiterorie
- Seite 89 und 90:
1. Hegemonial in der Polizei ist no
- Seite 91 und 92:
eines Sachbearbeiters, eine Entsche
- Seite 93 und 94:
timität) orientiert, während es i
- Seite 95 und 96:
sem Zusammenhang sowohl die polizei
- Seite 97 und 98:
dass die Polizisten ihren Job mit d
- Seite 99 und 100:
delnden Polizeibeamten betrachtet,
- Seite 101 und 102:
nicht zum Ausdruck, dass die oben g
- Seite 103 und 104:
und allen Anforderungen an eine mod
- Seite 105 und 106:
ezeichnet. Als besonders relevant w
- Seite 107 und 108:
Selbst bei einer simplen Verkehrsko
- Seite 109 und 110:
- Welche dieser Situationen sind so
- Seite 111 und 112:
mit Schwerpunkten zu ausgewählten
- Seite 113 und 114:
Mit dem veränderten Rechtsverstän
- Seite 115 und 116:
elevant erachtet und in die Tagesbe
- Seite 117 und 118:
- Gefährdung von Polizeibeamten be
- Seite 119 und 120:
Bildung terroristischer Vereinigung
- Seite 121 und 122:
Trunkenheit im Verkehr und Verstoß
- Seite 123 und 124:
Polizei, erstattet eine Anzeige und
- Seite 125 und 126:
- Bei einer Bedrohungslage, als ein
- Seite 127 und 128:
- Zehn Mal Widerstand gegen Vollstr
- Seite 129 und 130:
zusammen, dass im Land Brandenburg
- Seite 131 und 132:
nicht voraussagen. Die Wirkung der
- Seite 133 und 134:
ckungsbeamte Gefährliche Körperve
- Seite 135 und 136:
mit einem gewissen Maß an Vorsicht
- Seite 137 und 138:
Bedrohung, u.a. in Verbindung mit G
- Seite 139 und 140:
Taschenmesser Verstoß gegen das Sp
- Seite 141 und 142:
Besonders schwerer Fall des Diebsta
- Seite 143 und 144:
Körperverletzung und Verstoß gege
- Seite 145 und 146:
Die Tageberichte ermöglichen auch
- Seite 147 und 148:
Jugendliche Gruppengewalt 1 Am häu
- Seite 149 und 150:
Gefährlichkeit und/oder Öffentlic
- Seite 151 und 152:
griff kommt, in Beziehung setzen la
- Seite 153 und 154:
den Beamten vor Ort jedoch persönl
- Seite 155 und 156:
chen Möglichkeiten korrekt einsch
- Seite 157 und 158:
Weiterhin wurde festgestellt, dass
- Seite 159 und 160:
- Die überwiegende Mehrheit der T
- Seite 161 und 162:
- in ca. 8 % der Fälle ein Biss de
- Seite 163 und 164:
ei Zugriff 5,2 bei Androhung von Zw
- Seite 165 und 166:
auch für die Täter und für Unbet
- Seite 167 und 168: von Verkehrsordnungswidrigkeiten. M
- Seite 169 und 170: er beruflichen Erfahrung, die für
- Seite 171 und 172: Blue-box oder für das Training mit
- Seite 173 und 174: von waren männlich und 26 weiblich
- Seite 175 und 176: tensmuster unter Einbeziehung umfan
- Seite 177 und 178: aggressiv eingeschätzt wurde, blie
- Seite 179 und 180: sche Schlussfolgerungen gezogen wer
- Seite 181 und 182: dabei die anderen Ziele der Polizei
- Seite 183 und 184: dem sich Konzepte moderner Verhalte
- Seite 185 und 186: tik/Eigensicherung, Nichtschießen/
- Seite 187 und 188: techniken“ und „Kommunikationst
- Seite 189 und 190: oder gegen Frauen, das Überbringen
- Seite 191 und 192: die auf Verhaltensänderung abzielt
- Seite 193 und 194: seinen Platz fand, wurde in der Pol
- Seite 195 und 196: Bei der Brandenburger Polizei, die
- Seite 197 und 198: zw. Ju-Jutsu-Techniken, die speziel
- Seite 199 und 200: Sowohl im Training des Nichtschieß
- Seite 201 und 202: 4.2 Der methodisch-didaktische Rahm
- Seite 203 und 204: Intension, Thematik, Methoden und M
- Seite 205 und 206: diesem Konzept wird völlig vernach
- Seite 207 und 208: Bei dem didaktischen Rahmen, der di
- Seite 209 und 210: mer zum Verbinden der einzelnen Fac
- Seite 211 und 212: 1997, S. 590) Eine weitere theoreti
- Seite 213 und 214: 4. eine Integration von Theorie und
- Seite 215 und 216: können die Polizeibeamten feststel
- Seite 217: - Zunächst zuhören, gegebenenfall
- Seite 221 und 222: Bundesländern große Unterschiede.
- Seite 223 und 224: - die Effektivität der Trainings,
- Seite 225 und 226: - Die Interessen der Seminargruppe
- Seite 227 und 228: effekt erzielen, als bisher. (Hornu
- Seite 229 und 230: orientiert sich - wie die Integrier
- Seite 231 und 232: - Rollenspiele, wobei der Begriff
- Seite 233 und 234: - Abwehr- und Zugriffstraining, (AZ
- Seite 235 und 236: - Training PAKET ist ein polizeilic
- Seite 237 und 238: ningszeit wird sehr flexibel gehand
- Seite 239 und 240: cherheitsholster, Schlagstock, Hand
- Seite 241 und 242: Fortbildung wurde als die wichtigst
- Seite 243 und 244: - die Planung und Organisation des
- Seite 245 und 246: Polizeibehörde/-einrichtung IF-Tra
- Seite 247 und 248: - Das IF-Wochentraining für alle A
- Seite 249 und 250: - das Dezernat A 2.3 (Verhaltenstra
- Seite 251 und 252: nun einen direkten und erkennbaren
- Seite 253 und 254: vorschläge“ der dienstlichen Lei
- Seite 255 und 256: und Mitarbeitern der Vorbereitungss
- Seite 257 und 258: en Bedingungen und den Anforderunge
- Seite 259 und 260: verantwortet werden sollen.“ (MIB
- Seite 261 und 262: Lernen einer Organisation beruht au
- Seite 263 und 264: der Flexibilität der Organisation.
- Seite 265 und 266: verschiedenen Bundesländern nötig
- Seite 267 und 268: henden Aufbaus der Organisation Pol
- Seite 269 und 270:
munikation innerhalb der Polizei fu
- Seite 271 und 272:
Zielsetzungen der Fortbildungsmaßn
- Seite 273 und 274:
ging, einen bekannten, aber nicht m
- Seite 275 und 276:
In einem zielgenerierenden Entwickl
- Seite 277 und 278:
und muss auch nicht das Ziel der In
- Seite 279 und 280:
gezeigt, dass ein derartiges Herang
- Seite 281 und 282:
Verhaltensvorschläge, die der Trai
- Seite 283 und 284:
lär ist. Ein Ei gleicht dem andere
- Seite 285 und 286:
einschreiten mit einem Spruch wie:
- Seite 287 und 288:
auf alle äußeren oder inneren Bed
- Seite 289 und 290:
Im Falle einer kontrollierbaren Str
- Seite 291 und 292:
gebrauch deutlich erhöhen. Vorauss
- Seite 293 und 294:
Furcht hat man vor etwas Bekanntem,
- Seite 295 und 296:
egriff, der eine Bedrohungslage mit
- Seite 297 und 298:
tionen und Strategien unbrauchbar s
- Seite 299 und 300:
einzuversetzen. Mit derartigen Roll
- Seite 301 und 302:
derartigen Situationen wird das Auf
- Seite 303 und 304:
zittern - achten. Verhaltensweisen
- Seite 305 und 306:
[...] reagieren. Angstverminderung
- Seite 307 und 308:
Kompetenzerwerb die Einbeziehung de
- Seite 309 und 310:
Belastungen ausgesetzt, die jedoch
- Seite 311 und 312:
Oberbegriff für verschiedene Lehr-
- Seite 313 und 314:
Polizeipräsidenten bestimmte Semin
- Seite 315 und 316:
Weiterhin werden besondere Ereignis
- Seite 317 und 318:
dien aufgegriffenen polizeilichen E
- Seite 319 und 320:
usw., die während eines Interviews
- Seite 321 und 322:
nen, oder aber Fallbeispiele, die -
- Seite 323 und 324:
Beschreibung von selbst erlebten Si
- Seite 325 und 326:
systemische Grundsätze, wie der Th
- Seite 327 und 328:
Wirklichkeit der im Vollzugsdienst
- Seite 329 und 330:
auf eine bestimmte, mehr oder wenig
- Seite 331 und 332:
nistheorie auch Möglichkeiten zur
- Seite 333 und 334:
en Gegenstand durch die Ergebnisse
- Seite 335 und 336:
Lernen erfolgt also grundsätzlich
- Seite 337 und 338:
teiligten zu erreichen, ist zwar,
- Seite 339 und 340:
onen lässt sich dabei nicht planen
- Seite 341 und 342:
hinweisen. (Schäffter 1993, S. 293
- Seite 343 und 344:
Die wichtigste interkulturelle Komp
- Seite 345 und 346:
Polizei ist die „innersprachliche
- Seite 347 und 348:
tion im Rahmen der Europäischen Un
- Seite 349 und 350:
(Arnold, Siebert 1995, S. 1) entwic
- Seite 351 und 352:
(Klinikum, Krankenhaus), d.h. sie s
- Seite 353 und 354:
6 Neugestaltung der Seminare der In
- Seite 355 und 356:
ges durch die Trainer möglich wär
- Seite 357 und 358:
Rolle als „Anreger und Verstärke
- Seite 359 und 360:
der Gruppenstruktur: „Die Gemeins
- Seite 361 und 362:
le waren also von geringem Wert ode
- Seite 363 und 364:
xiserprobte und meist auch praxista
- Seite 365 und 366:
lebnisse frei zu schildern. Hier er
- Seite 367 und 368:
minarteilnehmer sammeln muss, ohne
- Seite 369 und 370:
satz im Rollenspiel nachzugestalten
- Seite 371 und 372:
Auch kann es organisatorisch nicht
- Seite 373 und 374:
der Aufmerksamkeitsforschung, einen
- Seite 375 und 376:
anstrengungslos‘ erlebt. Bei den
- Seite 377 und 378:
zeibeamten auch tatsächlich mögli
- Seite 379 und 380:
kamera, um den Seminarteilnehmern i
- Seite 381 und 382:
Schusswaffeneinsatzes auch im Freie
- Seite 383 und 384:
valuieren verlangt die Fähigkeit,
- Seite 385 und 386:
interessant, da in beiden Bundeslä
- Seite 387 und 388:
Rollenspielen ist kompliziert. Herm
- Seite 389 und 390:
Evaluationsdesign nach Schratz, Iby
- Seite 391 und 392:
thode führt aber zu keinen brauchb
- Seite 393 und 394:
Gruppe 3: Training Messung 2 Mit Hi
- Seite 395 und 396:
Die komplexen Verhaltensänderungen
- Seite 397 und 398:
und Lagen verfügt jeder Polizeibea
- Seite 399 und 400:
Verhaltensweisen ersetzen. Es stell
- Seite 401 und 402:
So werden von den Polizeibeamten b
- Seite 403 und 404:
erklärt die konstruktivistische Er
- Seite 405 und 406:
den Anforderungen an eine moderne P
- Seite 407 und 408:
tensänderungen zu erreichen, die z
- Seite 409 und 410:
Literaturverzeichnis Ackermann-Lieb
- Seite 411 und 412:
Polizeirundschau. 2002, 8, S.17, 24
- Seite 413 und 414:
Hessisches Ministerium des Innern 1
- Seite 415 und 416:
Keupp 1988: Keupp, Heiner: Auf dem
- Seite 417 und 418:
and General Police Assaults. Journa
- Seite 419 und 420:
Peters, Zillmann 2004: Peters, Gerd
- Seite 421 und 422:
deshauptstadt Düsseldorf. Schrifte
- Seite 423 und 424:
S.5-6, Wanderer, Thieme 1992: Wande
- Seite 425 und 426:
Danksagung Mein Dank gilt Frau Nina
- Seite 427:
Eidesstattliche Erklärung Hiermit


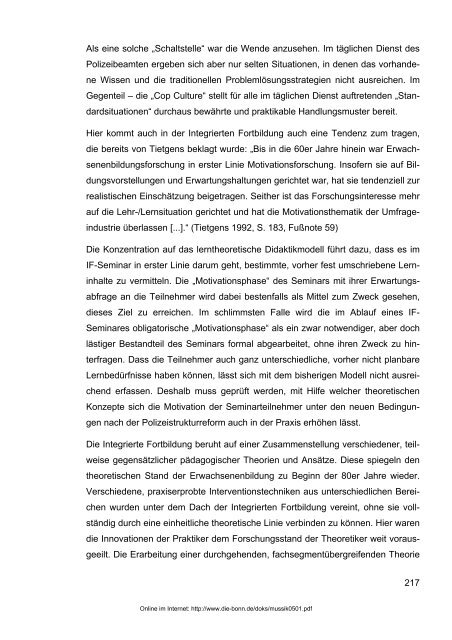


![PDF [KB 892] - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung](https://img.yumpu.com/7495168/1/144x260/pdf-kb-892-deutsches-institut-fur-erwachsenenbildung.jpg?quality=85)