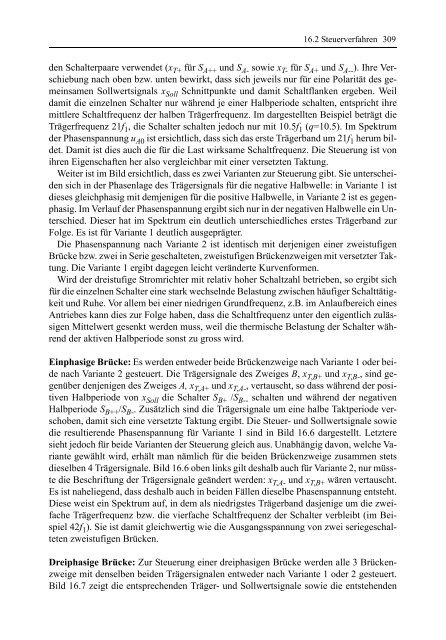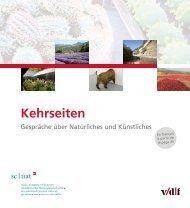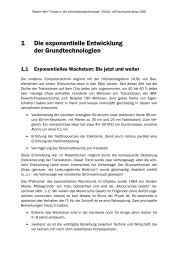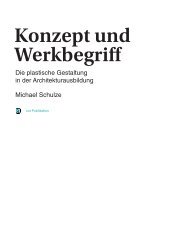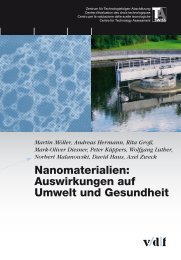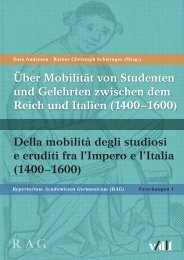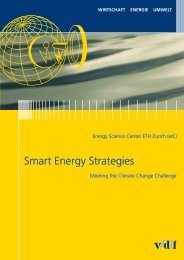Untitled - vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Untitled - vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Untitled - vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
16.2 Steuerverfahren 309<br />
den Schalterpaare verwendet (x T+ für S A++ und S A- sowie x T- für S A+ und S A-- ). Ihre Verschiebung<br />
nach oben bzw. unten bewirkt, dass sich jeweils nur für eine Polarität des gemeinsamen<br />
Sollwertsignals x Soll Schnittpunkte und damit Schaltfl<strong>an</strong>ken ergeben. Weil<br />
damit die einzelnen Schalter nur während je einer Halbperiode schalten, entspricht ihre<br />
mittlere Schaltfrequenz <strong>der</strong> halben Trägerfrequenz. Im dargestellten Beispiel beträgt die<br />
Trägerfrequenz 21f 1, die Schalter schalten jedoch nur mit 10.5f 1 (q=10.5). Im Spektrum<br />
<strong>der</strong> Phasensp<strong>an</strong>nung u A0 ist ersichtlich, dass sich das erste Trägerb<strong>an</strong>d um 21f 1 herum bildet.<br />
Damit ist dies auch die für die Last wirksame Schaltfrequenz. Die Steuerung ist von<br />
ihren Eigenschaften her also vergleichbar mit einer versetzten Taktung.<br />
Weiter ist im Bild ersichtlich, dass es zwei Vari<strong>an</strong>ten zur Steuerung gibt. Sie unterscheiden<br />
sich in <strong>der</strong> Phasenlage des Trägersignals für die negative Halbwelle: in Vari<strong>an</strong>te 1 ist<br />
dieses gleichphasig mit demjenigen für die positive Halbwelle, in Vari<strong>an</strong>te 2 ist es gegenphasig.<br />
Im Verlauf <strong>der</strong> Phasensp<strong>an</strong>nung ergibt sich nur in <strong>der</strong> negativen Halbwelle ein Unterschied.<br />
Dieser hat im Spektrum ein deutlich unterschiedliches erstes Trägerb<strong>an</strong>d zur<br />
Folge. Es ist für Vari<strong>an</strong>te 1 deutlich ausgeprägter.<br />
Die Phasensp<strong>an</strong>nung nach Vari<strong>an</strong>te 2 ist identisch mit <strong>der</strong>jenigen einer zweistufigen<br />
Brücke bzw. zwei in Serie geschalteten, zweistufigen Brückenzweigen mit versetzter Taktung.<br />
Die Vari<strong>an</strong>te 1 ergibt dagegen leicht verän<strong>der</strong>te Kurvenformen.<br />
Wird <strong>der</strong> dreistufige Stromrichter mit relativ hoher Schaltzahl betrieben, so ergibt sich<br />
für die einzelnen Schalter eine stark wechselnde Belastung zwischen häufiger Schalttätigkeit<br />
und Ruhe. Vor allem bei einer niedrigen Grundfrequenz, z.B. im Anlaufbereich eines<br />
Antriebes k<strong>an</strong>n dies zur Folge haben, dass die Schaltfrequenz unter den eigentlich zulässigen<br />
Mittelwert gesenkt werden muss, weil die thermische Belastung <strong>der</strong> Schalter während<br />
<strong>der</strong> aktiven Halbperiode sonst zu gross wird.<br />
Einphasige Brücke: Es werden entwe<strong>der</strong> beide Brückenzweige nach Vari<strong>an</strong>te 1 o<strong>der</strong> beide<br />
nach Vari<strong>an</strong>te 2 gesteuert. Die Trägersignale des Zweiges B, x T,B+ und x T,B-, sind gegenüber<br />
denjenigen des Zweiges A, x T,A+ und x T,A-, vertauscht, so dass während <strong>der</strong> positiven<br />
Halbperiode von x Soll die Schalter S B+ /S B-- schalten und während <strong>der</strong> negativen<br />
Halbperiode S B++/S B-. Zusätzlich sind die Trägersignale um eine halbe Taktperiode verschoben,<br />
damit sich eine versetzte Taktung ergibt. Die Steuer- und Sollwertsignale sowie<br />
die resultierende Phasensp<strong>an</strong>nung für Vari<strong>an</strong>te 1 sind in Bild 16.6 dargestellt. Letztere<br />
sieht jedoch für beide Vari<strong>an</strong>ten <strong>der</strong> Steuerung gleich aus. Unabhängig davon, welche Vari<strong>an</strong>te<br />
gewählt wird, erhält m<strong>an</strong> nämlich für die beiden Brückenzweige zusammen stets<br />
dieselben 4 Trägersignale. Bild 16.6 oben links gilt deshalb auch für Vari<strong>an</strong>te 2, nur müsste<br />
die Beschriftung <strong>der</strong> Trägersignale geän<strong>der</strong>t werden: x T,A- und x T,B+ wären vertauscht.<br />
Es ist naheliegend, dass deshalb auch in beiden Fällen dieselbe Phasensp<strong>an</strong>nung entsteht.<br />
Diese weist ein Spektrum auf, in dem als niedrigstes Trägerb<strong>an</strong>d dasjenige um die zweifache<br />
Trägerfrequenz bzw. die vierfache Schaltfrequenz <strong>der</strong> Schalter verbleibt (im Beispiel<br />
42f 1). Sie ist damit gleichwertig wie die Ausg<strong>an</strong>gssp<strong>an</strong>nung von zwei seriegeschalteten<br />
zweistufigen Brücken.<br />
Dreiphasige Brücke: Zur Steuerung einer dreiphasigen Brücke werden alle 3 Brückenzweige<br />
mit denselben beiden Trägersignalen entwe<strong>der</strong> nach Vari<strong>an</strong>te 1 o<strong>der</strong> 2 gesteuert.<br />
Bild 16.7 zeigt die entsprechenden Träger- und Sollwertsignale sowie die entstehenden