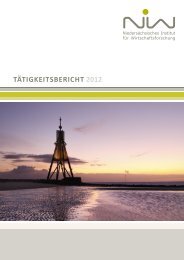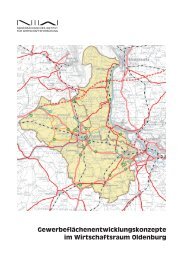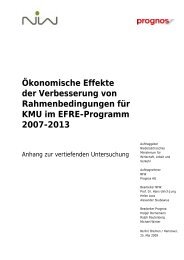- Seite 1 und 2:
Berufliche Rehabilitation Fakten |
- Seite 3 und 4:
- 2 - Erfahrungen mit der Evaluatio
- Seite 5 und 6:
__ __ Mitglieder des Projektbeirats
- Seite 8 und 9: Basisstudie „Reha-Prozessdatenpan
- Seite 10 und 11: 4.2.1. Exkurs: Erwerbskarrieren vor
- Seite 12 und 13: Tabellenverzeichnis (Text) Tabelle
- Seite 14 und 15: Tabellenverzeichnis (Anhang) Tabell
- Seite 16 und 17: Tabelle A 53: Rehabilitanden nach A
- Seite 18 und 19: Abkürzungsverzeichnis ABM Arbeitsb
- Seite 20 und 21: I. Einleitung Die berufliche Rehabi
- Seite 22 und 23: ständig ist. Die Bundesagentur fü
- Seite 24 und 25: sowie die Prüfung, ob für die Bea
- Seite 26 und 27: II. Datengrundlagen 1. Einleitung D
- Seite 28 und 29: der Ausbildung, Schulinformationen,
- Seite 30 und 31: Abbildung 4: VerBIS-Kundendaten mit
- Seite 32 und 33: stellt. Damit mussten auch diese f
- Seite 34 und 35: gen auch die Merkmale gewissen Ver
- Seite 36 und 37: Endedatum aufweist, dann wird er be
- Seite 38 und 39: Rehabilitationsspezifische Maßnahm
- Seite 40 und 41: 3.2.2. Anreicherung mit maßnahmebe
- Seite 42 und 43: Tabelle 5: Quellen der IEB BeH Besc
- Seite 44 und 45: Datenversion RehaPro Tabelle 6: Dat
- Seite 46 und 47: Daher ist es nicht möglich, aus de
- Seite 48 und 49: 3.5. Zusammenfassender Überblick
- Seite 50 und 51: Integration der IEB andere Zeiten d
- Seite 52 und 53: P81 explizit angegeben werden, vor
- Seite 54 und 55: administrativen Prozess der Vermitt
- Seite 56 und 57: eeinflussen. Im Kontext von Behinde
- Seite 60 und 61: Werkstätten für behinderte Mensch
- Seite 62 und 63: tungs- und Verwaltungstätigkeiten,
- Seite 64 und 65: Einschränkungen von Kunden zum Erh
- Seite 66 und 67: sonen mit einer psychischen Behinde
- Seite 68 und 69: Tabelle 11: Rehabilitanden nach Art
- Seite 70 und 71: Über die Hälfte der Rehabilitande
- Seite 72 und 73: Tabelle 12: Laufende und bereits be
- Seite 74 und 75: e 2007 bis 2009 hinweg, sinkt der A
- Seite 76 und 77: schnittlichen Laufzeit zeigen. Aber
- Seite 78 und 79: seits daher, dass Informationen zur
- Seite 80 und 81: Rehabilitanden mit einer Behinderun
- Seite 82 und 83: Denn neben der an der gesetzlichen
- Seite 84 und 85: derkategorie und der hochaggregiert
- Seite 86 und 87: Tabelle 14: Maßnahmearten nach dif
- Seite 88 und 89: 5 im Anhang). Es gibt sowohl Agentu
- Seite 90 und 91: Gruppe der Personen mit Unterstütz
- Seite 92 und 93: Abbildung 13: Verteilung der Maßna
- Seite 94 und 95: SGB III-Bereichs sind neben stark a
- Seite 96 und 97: 6. Selektionsprozesse beim Zugang i
- Seite 98 und 99: städtisch geprägten Bezirken mit
- Seite 100 und 101: Typ III: Städtische Bezirke mit g
- Seite 102 und 103: geboten (Degener 1994; Michel und H
- Seite 104 und 105: Abbildung 15: Übergang in die erst
- Seite 106 und 107: Zusätzlich ist zu beachten, dass M
- Seite 108 und 109:
Abbildung 18: Maßnahmesequenzmuste
- Seite 110 und 111:
7.2. Wiedereingliederung Vorbemerku
- Seite 112 und 113:
Abbildung 21: Maßnahmesequenzmuste
- Seite 114 und 115:
8.1. Ersteingliederung In der Erste
- Seite 116 und 117:
Eine wichtige Rolle beim Übergang
- Seite 118 und 119:
dem allgemeinen Arbeitsmarkt eröff
- Seite 120 und 121:
10. Zusammenfassung Die deskriptive
- Seite 122 und 123:
IV. Machbarkeitsstudie Daten des Ä
- Seite 124 und 125:
Erst- und Wiedereingliederung sind
- Seite 126 und 127:
verlaufen als bei körperlichen Erk
- Seite 128 und 129:
und kommt zu den Befunden, die in d
- Seite 130 und 131:
2. Anerkannte Rehabilitanden der Bu
- Seite 132 und 133:
eingliederung reicht von rund zehn
- Seite 134 und 135:
Person aufgrund eines besseren gesu
- Seite 136 und 137:
4.3. Verweildauermodelle Eine Alter
- Seite 138 und 139:
men eines dynamischen Modells, das
- Seite 140 und 141:
zur Behinderungsart bereithält. Li
- Seite 142 und 143:
tationsbedarf in Betracht ziehen un
- Seite 144 und 145:
Zusammengenommen heißt dies, dass
- Seite 146 und 147:
und zum anderen die Prozessdaten au
- Seite 148 und 149:
dungssuche bis hin zur Möglichkeit
- Seite 150 und 151:
Methoden o Wie unterscheiden sich A
- Seite 152 und 153:
Bisherige Forschung Im Gegensatz zu
- Seite 154 und 155:
der Instrumentvariablenansatz ebenf
- Seite 156 und 157:
7.2. Evaluation von Maßnahmen im R
- Seite 158 und 159:
Methoden o Wie unterscheiden sich A
- Seite 160 und 161:
ven Wirkungseffekten auf solche Per
- Seite 162 und 163:
Methoden o Ist die aufgenommene Bes
- Seite 164 und 165:
Abbildung 22: Übersichtsmatrix; Vo
- Seite 166 und 167:
VI. Zusammenfassung Ein wissenschaf
- Seite 168 und 169:
Teilnahme an einer Maßnahme oder a
- Seite 170 und 171:
sen die Rehabilitation häufiger au
- Seite 172 und 173:
zur Testung dieses Verfahrens erfol
- Seite 174 und 175:
Tabelle A 1: Rehabilitanden nach Ar
- Seite 176 und 177:
Tabelle A 3: Verteilung von Rehabil
- Seite 178 und 179:
Tabelle A 6: Anteile an der Art der
- Seite 180 und 181:
Tabelle A 8: Vorherige Schulart nac
- Seite 182 und 183:
Tabelle A 12: Maßnahmeanzahl pro R
- Seite 184 und 185:
Tabelle A 15: Art der Behinderung n
- Seite 186 und 187:
Tabelle A 17: Durchschnittliche Ma
- Seite 188 und 189:
Tabelle A 20: Dauer der Rehabilitat
- Seite 190 und 191:
Tabelle A 24: Rehabilitanden nach A
- Seite 192 und 193:
Tabelle A 28: Rehabilitanden nach A
- Seite 194 und 195:
Tabelle A 31: Status der Rehabilita
- Seite 196 und 197:
Tabelle A 33: Status der Rehabilita
- Seite 198 und 199:
Tabelle A 37: Förderkategorien nac
- Seite 200 und 201:
Tabelle A 39: Maßnahmeart nach Ges
- Seite 202 und 203:
Tabelle A 41: Maßnahmeart nach Beh
- Seite 204 und 205:
Abbildung A 1: Rehabilitationsspezi
- Seite 206 und 207:
Abbildung A 3: Allgemeine BvB nach
- Seite 208 und 209:
Abbildung A 5: Ausbildung der Benac
- Seite 210 und 211:
Tabelle A 44: Maßnahmeart nach Rec
- Seite 212 und 213:
Fortsetzung von Tabelle A 45: Maßn
- Seite 214 und 215:
Tabelle A 46: Maßnahmearten; 2007
- Seite 216 und 217:
Abbildung A 7: Allgemeine Weiterbil
- Seite 218 und 219:
Abbildung A 9: Rehabilitationsspezi
- Seite 220 und 221:
Tabelle A 47: Rehabilitanden nach M
- Seite 222 und 223:
Tabelle A 50: Multivariate Ergebnis
- Seite 224 und 225:
Tabelle A 54: Rehabilitanden nach M
- Seite 226 und 227:
Tabelle A 56: Maßnahmen pro Person
- Seite 228 und 229:
Tabelle A 59: Maßnahmen pro Person
- Seite 230 und 231:
Tabelle A 62: Rehabilitanden nach d
- Seite 232 und 233:
Männer Beibehaltung Arbeits- /Ausb
- Seite 234 und 235:
Tabelle A 64: Verbleib nach Ende de
- Seite 236 und 237:
Frauen Endegrund Beibehalt ung Arbe
- Seite 238 und 239:
Tabelle A 66: Verbleib nach Ende de
- Seite 240 und 241:
Frauen Endegrund Beibehaltu ng Arbe
- Seite 242 und 243:
Männer Endegrund Beibehaltung Arbe
- Seite 244 und 245:
Tabelle A 68: Zuordnung der Einzelm
- Seite 246 und 247:
Kategorien Name der Einzelmaßnahme
- Seite 248 und 249:
Kategorien Name der Einzelmaßnahme
- Seite 250 und 251:
Bundesagentur für Arbeit (2008). H
- Seite 252 und 253:
Dietrich, H. und Plicht, H. (2009).
- Seite 254 und 255:
Michel, M. und Häußler-Sczepan, M
- Seite 256 und 257:
ZEW et al. (2006). Evaluation der M
- Seite 259 und 260:
Berlin, 2. Januar 2012 Im Auftrag d
- Seite 261 und 262:
8.2 Querauswertungen der Fallstudie
- Seite 263 und 264:
Tabellen im Anhang Tabelle A 1 Schi
- Seite 265 und 266:
Zusammenfassung Die Implementations
- Seite 267 und 268:
1 Einleitung Behinderte Menschen ha
- Seite 269 und 270:
kein Schwerpunkt liegen sollte. 5 Z
- Seite 271 und 272:
schen Bias besitzt. Möglicherweise
- Seite 273 und 274:
esondere Rechte und Anspruch auf ge
- Seite 275 und 276:
entschädigung, Träger der öffent
- Seite 277 und 278:
Bei den Leistungen zur Teilhabe am
- Seite 279 und 280:
Leistungen an behinderte Menschen (
- Seite 281 und 282:
3.2 Organisation der Reha-Bereiche,
- Seite 283 und 284:
Übliche Organisation von Reha-Aufg
- Seite 285 und 286:
3.3 Ergebnisse der E-Mail-Befragung
- Seite 287 und 288:
• die Rückübertragung der beruf
- Seite 289 und 290:
Zusammenarbeit wird dort jedoch sel
- Seite 291 und 292:
4 Zugang zu Leistungen zur Teilhabe
- Seite 293 und 294:
Potenzielle Rehabilitandinnen und R
- Seite 295 und 296:
zugelassen. Bestätigen die Gutacht
- Seite 297 und 298:
In einer Agentur gab es zusätzlich
- Seite 299 und 300:
vollständig, auch wenn aufgrund vo
- Seite 301 und 302:
fangreiche Schulungen für pAp, Fal
- Seite 303 und 304:
ufsberatung der Agentur für Arbeit
- Seite 305 und 306:
isherige Beruf aufgrund gesundheitl
- Seite 307 und 308:
In einer Agentur wurde berichtet, d
- Seite 309 und 310:
5.2.5 Anerkennung bei Fremdkostentr
- Seite 311 und 312:
In welchen Fällen bewilligen Sie R
- Seite 313 und 314:
6 Rolle der Fachdienste 6.1 Untersu
- Seite 315 und 316:
ung der Dienstleistungen des psycho
- Seite 317 und 318:
Als ein weiteres Problem wurde in e
- Seite 319 und 320:
Aussagekraft der Gutachten Als Prob
- Seite 321 und 322:
aus diesem Grund als notwendig erac
- Seite 323 und 324:
7 Beratungskonzepte und Empowerment
- Seite 325 und 326:
Empowerment Als einen Referenzpunkt
- Seite 327 und 328:
Institutioneller Rahmen der Beratun
- Seite 329 und 330:
Beratungs-Typ Zitat 1) Macherin /
- Seite 331 und 332:
Hingegen beenden Beratende des Typs
- Seite 333 und 334:
8 Auswahl von Maßnahmen 8.1 Unters
- Seite 335 und 336:
oder die Herstellung der Ausbildung
- Seite 337 und 338:
Ausbildungen (sog. Werkerberufe) vo
- Seite 339 und 340:
tiven Ebene über spezielle Schulun
- Seite 341 und 342:
griffen oder das Reha-Verfahren wir
- Seite 343 und 344:
Schwerpunktsetzungen auf Rehabilita
- Seite 345 und 346:
8.2.6 Maßnahmenauswahl für Kundin
- Seite 347 und 348:
8.3 Ergebnisse standardisierter Bef
- Seite 349 und 350:
• „fehlende Plätze in der allg
- Seite 351 und 352:
derungschancen bewertet wurden, des
- Seite 353 und 354:
• Im Rahmen der Studie konnten Da
- Seite 355 und 356:
Wie wirkten sich zwischen Juli 2010
- Seite 357 und 358:
Unterschiedliche Prämissen der Reh
- Seite 359 und 360:
9 Absolventenmanagement 9.1 Untersu
- Seite 361 und 362:
tureller Bias produziert, sich eher
- Seite 363 und 364:
9.2.5 Zwischenfazit aus den Fallstu
- Seite 365 und 366:
• die Zeit bis zur Integration in
- Seite 367 und 368:
die Schule verlassen und anderersei
- Seite 369 und 370:
In einer Agentur wurde darauf hinge
- Seite 371 und 372:
Wie viele Wochen vorher informieren
- Seite 373 und 374:
11 Gender 11.1 Untersuchungsgegenst
- Seite 375 und 376:
In einer Agentur wurden deshalb ber
- Seite 377 und 378:
Für die Wiedereingliederung wurden
- Seite 379 und 380:
12 Typenbildung von Agenturen In de
- Seite 381 und 382:
der Benachteiligtenförderung) unte
- Seite 383 und 384:
men, von denen sie die größte Fö
- Seite 385 und 386:
versicherungspflichtige Beschäftig
- Seite 387 und 388:
Träger. Die relevante Frage für z
- Seite 389 und 390:
Zeitlicher Verlauf der Reha-Verläu
- Seite 391 und 392:
Wirkungsanalysen sicherlich eine wi
- Seite 393 und 394:
14 Anlagen 14.1 Ausführungen zu Me
- Seite 395 und 396:
zum Teil voneinander ab (z. B. eine
- Seite 397 und 398:
Rücklauf der E-Mail-Befragung Die
- Seite 399 und 400:
Rücklauf Grundsicherungsstellen Br
- Seite 401 und 402:
ihren Reha-Prozess sehr kritisch wa
- Seite 403 und 404:
Berufliche Abschlüsse / Vorerfahru
- Seite 405 und 406:
Rahmenbedingungen der Grundsicherun
- Seite 407 und 408:
Fälle (SGB II), in denen Prüfung
- Seite 409 und 410:
Maßnahmen zufällig auszuwählende
- Seite 411 und 412:
Regression für abhängige Variable
- Seite 413 und 414:
Angaben in Prozent Durchschnittlich
- Seite 415 und 416:
Spearman-Rho * = signifikant auf de
- Seite 417 und 418:
Clusteranalyse über Variablen mit
- Seite 419 und 420:
14.3 Berufliche Rehabilitation aus
- Seite 421 und 422:
sönlichen Ziele im Verlauf der Ber
- Seite 423 und 424:
14.4.1 Leitfäden in Grundsicherung
- Seite 425 und 426:
• Wie gestaltet sich die Interakt
- Seite 427 und 428:
7. Wie viele der aktuellen Reha-Ber
- Seite 429 und 430:
stärker genauso stark weniger star
- Seite 431 und 432:
C) Zugang von Rehabilitanden/-innen
- Seite 433 und 434:
17. Fragen zum dritten Fall 16. Fra
- Seite 435 und 436:
27. In welchen Fällen der Wiederei
- Seite 437 und 438:
14.4.5 Standardisierte Befragung de
- Seite 439 und 440:
zentraler Einfluss großer ... geri
- Seite 441 und 442:
14.5 Zeitlicher Ablauf der Implemen
- Seite 443 und 444:
Fallstudien-Nr. Funktion Kennung 5a
- Seite 445 und 446:
Fallstudien-Nr. Funktion Kennung Re
- Seite 447 und 448:
BA (2010c). Leitfaden Teilhabe am A
- Seite 449 und 450:
World Health Organization (WHO) (20
- Seite 452 und 453:
Zur Machbarkeit einer Evaluation de
- Seite 454 und 455:
EINLEITUNG: ZUR EVALUATION DER ARBE
- Seite 456 und 457:
EINORDNUNG DER ANALYSE Die erste St
- Seite 458 und 459:
EINORDNUNG DER ANALYSE ßen Träger
- Seite 460 und 461:
EINORDNUNG DER ANALYSE Stufe dieser
- Seite 462 und 463:
ANFORDERUNGEN AN EINE MIKROÖKONOMI
- Seite 464 und 465:
ANFORDERUNGEN AN EINE MIKROÖKONOMI
- Seite 466 und 467:
ANFORDERUNGEN AN EINE MIKROÖKONOMI
- Seite 468 und 469:
ANFORDERUNGEN AN EINE MIKROÖKONOMI
- Seite 470 und 471:
ANFORDERUNGEN AN EINE MIKROÖKONOMI
- Seite 472 und 473:
ANFORDERUNGEN AN EINE MIKROÖKONOMI
- Seite 474 und 475:
ANFORDERUNGEN AN EINE MIKROÖKONOMI
- Seite 476 und 477:
ERGEBNISSE DER IMPLEMENTATIONSSTUDI
- Seite 478 und 479:
ERGEBNISSE DER IMPLEMENTATIONSSTUDI
- Seite 480 und 481:
ERGEBNISSE DER IMPLEMENTATIONSSTUDI
- Seite 482 und 483:
ERGEBNISSE DER IMPLEMENTATIONSSTUDI
- Seite 484 und 485:
ERGEBNISSE DER IMPLEMENTATIONSSTUDI
- Seite 486 und 487:
ERGEBNISSE DER IMPLEMENTATIONSSTUDI
- Seite 488 und 489:
ERGEBNISSE DER IMPLEMENTATIONSSTUDI
- Seite 490 und 491:
BEURTEILUNG DER VORGESCHLAGENEN ANS
- Seite 492 und 493:
BEURTEILUNG DER VORGESCHLAGENEN ANS
- Seite 494 und 495:
BEURTEILUNG DER VORGESCHLAGENEN ANS
- Seite 496 und 497:
LITERATUR Deutscher Bundestag (2008


![Berufliche Rehabilitation [PDF, 6MB] - Bundesministerium für Arbeit ...](https://img.yumpu.com/11169824/58/500x640/berufliche-rehabilitation-pdf-6mb-bundesministerium-fur-arbeit-.jpg)