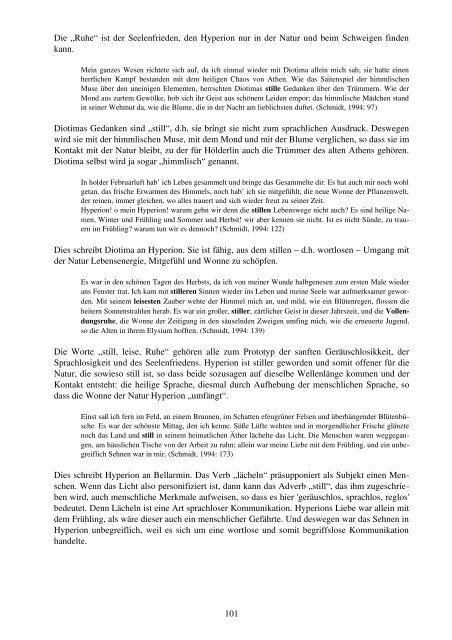die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die „Ruhe“ ist <strong>de</strong>r Seelenfrie<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>n Hyperion nur in <strong>de</strong>r Natur und beim Schweigen fin<strong>de</strong>n<br />
kann.<br />
Mein ganzes Wesen richtete sich auf, da ich einmal wie<strong>de</strong>r mit Diotima allein mich sah; sie hatte einen<br />
herrlichen Kampf bestan<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>m heiligen Chaos von Athen. Wie das Saitenspiel <strong>de</strong>r himmlischen<br />
Muse über <strong>de</strong>n uneinigen Elementen, herrschten Diotimas stille Gedanken über <strong>de</strong>n Trümmern. Wie <strong>de</strong>r<br />
Mond aus zartem Gewölke, hob sich ihr Geist aus schönem Lei<strong>de</strong>n empor; das himmlische Mädchen stand<br />
in seiner Wehmut da, wie <strong>die</strong> Blume, <strong>die</strong> in <strong>de</strong>r Nacht am lieblichsten duftet. (Schmidt, 1994: 97)<br />
Diotimas Gedanken sind „still“, d.h. sie bringt sie nicht zum sprachlichen Ausdruck. Deswegen<br />
wird sie mit <strong>de</strong>r himmlischen Muse, mit <strong>de</strong>m Mond und mit <strong>de</strong>r Blume verglichen, so dass sie im<br />
Kontakt mit <strong>de</strong>r Natur bleibt, zu <strong>de</strong>r für Höl<strong>de</strong>rlin auch <strong>die</strong> Trümmer <strong>de</strong>s alten Athens gehören.<br />
Diotima selbst wird ja sogar „himmlisch“ genannt.<br />
In hol<strong>de</strong>r Februarluft hab’ ich Leben gesammelt und bringe das Gesammelte dir. Es hat auch mir noch wohl<br />
getan, das frische Erwarmen <strong>de</strong>s Himmels, noch hab’ ich sie mitgefühlt, <strong>die</strong> neue Wonne <strong>de</strong>r Pflanzenwelt,<br />
<strong>de</strong>r reinen, immer gleichen, wo alles trauert und sich wie<strong>de</strong>r freut zu seiner Zeit.<br />
Hyperion! o mein Hyperion! warum gehn wir <strong>de</strong>nn <strong>die</strong> stillen Lebenswege nicht auch? Es sind heilige Namen,<br />
Winter und Frühling und Sommer und Herbst! wir aber kennen sie nicht. Ist es nicht Sün<strong>de</strong>, zu trauern<br />
im Frühling? warum tun wir es <strong>de</strong>nnoch? (Schmidt, 1994: 122)<br />
Dies schreibt Diotima an Hyperion. Sie ist fähig, aus <strong>de</strong>m stillen – d.h. wortlosen – Umgang mit<br />
<strong>de</strong>r Natur Lebensenergie, Mitgefühl und Wonne zu schöpfen.<br />
Es war in <strong>de</strong>n schönen Tagen <strong>de</strong>s Herbsts, da ich von meiner Wun<strong>de</strong> halbgenesen zum ersten Male wie<strong>de</strong>r<br />
ans Fenster trat. Ich kam mit stilleren Sinnen wie<strong>de</strong>r ins Leben und meine Seele war aufmerksamer gewor<strong>de</strong>n.<br />
Mit seinem leisesten Zauber wehte <strong>de</strong>r Himmel mich an, und mild, wie ein Blütenregen, flossen <strong>die</strong><br />
heitern Sonnenstrahlen herab. Es war ein großer, stiller, zärtlicher Geist in <strong>die</strong>ser Jahrszeit, und <strong>die</strong> Vollendungsruhe,<br />
<strong>die</strong> Wonne <strong>de</strong>r Zeitigung in <strong>de</strong>n säuseln<strong>de</strong>n Zweigen umfing mich, wie <strong>die</strong> erneuerte Jugend,<br />
so <strong>die</strong> Alten in ihrem Elysium hofften. (Schmidt, 1994: 139)<br />
Die Worte „still, leise, Ruhe“ gehören alle zum Prototyp <strong>de</strong>r sanften Geräuschlosikkeit, <strong>de</strong>r<br />
Sprachlosigkeit und <strong>de</strong>s Seelenfrie<strong>de</strong>ns. Hyperion ist stiller gewor<strong>de</strong>n und somit offener für <strong>die</strong><br />
Natur, <strong>die</strong> sowieso still ist, so dass bei<strong>de</strong> sozusagen auf <strong>die</strong>selbe Wellenlänge kommen und <strong>de</strong>r<br />
Kontakt entsteht: <strong>die</strong> heilige Sprache, <strong>die</strong>smal durch Aufhebung <strong>de</strong>r menschlichen Sprache, so<br />
dass <strong>die</strong> Wonne <strong>de</strong>r Natur Hyperion „umfängt“.<br />
Einst saß ich fern im Feld, an einem Brunnen, im Schatten efeugrüner Felsen und überhängen<strong>de</strong>r Blütenbüsche.<br />
Es war <strong>de</strong>r schönste Mittag, <strong>de</strong>n ich kenne. Süße Lüfte wehten und in morgendlicher Frische glänzte<br />
noch das Land und still in seinem heimatlichen Äther lächelte das Licht. Die Menschen waren weggegangen,<br />
am häuslichen Tische von <strong>de</strong>r Arbeit zu ruhn; allein war meine Liebe mit <strong>de</strong>m Frühling, und ein unbegreiflich<br />
Sehnen war in mir. (Schmidt, 1994: 173)<br />
Dies schreibt Hyperion an Bellarmin. Das Verb „lächeln“ präsupponiert als Subjekt einen Menschen.<br />
Wenn das Licht also personifiziert ist, dann kann das Adverb „still“, das ihm zugeschrieben<br />
wird, auch menschliche Merkmale aufweisen, so dass es hier 'geräuschlos, sprachlos, reglos'<br />
be<strong>de</strong>utet. Denn Lächeln ist eine Art sprachloser Kommunikation. Hyperions Liebe war allein mit<br />
<strong>de</strong>m Frühling, als wäre <strong>die</strong>ser auch ein menschlicher Gefährte. Und <strong>de</strong>swegen war das Sehnen in<br />
Hyperion unbegreiflich, weil es sich um eine wortlose und somit begriffslose Kommunikation<br />
han<strong>de</strong>lte.<br />
101