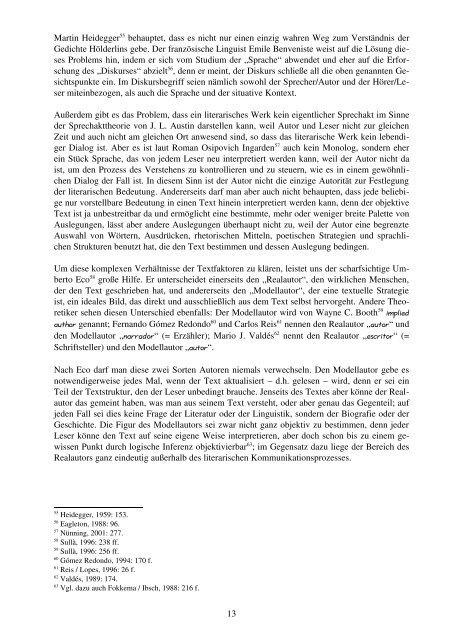die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Martin Hei<strong>de</strong>gger 55 behauptet, dass es nicht nur einen einzig wahren Weg zum Verständnis <strong>de</strong>r<br />
Gedichte Höl<strong>de</strong>rlins gebe. Der französische Linguist Emile Benveniste weist auf <strong>die</strong> Lösung <strong>die</strong>ses<br />
Problems hin, in<strong>de</strong>m er sich vom Studium <strong>de</strong>r „Sprache“ abwen<strong>de</strong>t und eher auf <strong>die</strong> Erforschung<br />
<strong>de</strong>s „Diskurses“ abzielt 56 , <strong>de</strong>nn er meint, <strong>de</strong>r Diskurs schließe all <strong>die</strong> oben genannten Gesichtspunkte<br />
ein. Im Diskursbegriff seien nämlich sowohl <strong>de</strong>r Sprecher/Autor und <strong>de</strong>r Hörer/Leser<br />
miteinbezogen, als auch <strong>die</strong> Sprache und <strong>de</strong>r situative Kontext.<br />
Außer<strong>de</strong>m gibt es das Problem, dass ein literarisches Werk kein eigentlicher Sprechakt im Sinne<br />
<strong>de</strong>r Sprechakttheorie von J. L. Austin darstellen kann, weil Autor und Leser nicht zur gleichen<br />
Zeit und auch nicht am gleichen Ort anwesend sind, so dass das literarische Werk kein lebendiger<br />
Dialog ist. Aber es ist laut Roman Osipovich Ingar<strong>de</strong>n 57 auch kein Monolog, son<strong>de</strong>rn eher<br />
ein Stück Sprache, das von je<strong>de</strong>m Leser neu interpretiert wer<strong>de</strong>n kann, weil <strong>de</strong>r Autor nicht da<br />
ist, um <strong>de</strong>n Prozess <strong>de</strong>s Verstehens zu kontrollieren und zu steuern, wie es in einem gewöhnlichen<br />
Dialog <strong>de</strong>r Fall ist. In <strong>die</strong>sem Sinn ist <strong>de</strong>r Autor nicht <strong>die</strong> einzige Autorität zur Festlegung<br />
<strong>de</strong>r literarischen Be<strong>de</strong>utung. An<strong>de</strong>rerseits darf man aber auch nicht behaupten, dass je<strong>de</strong> beliebige<br />
nur vorstellbare Be<strong>de</strong>utung in einen Text hinein interpretiert wer<strong>de</strong>n kann, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r objektive<br />
Text ist ja unbestreitbar da und ermöglicht eine bestimmte, mehr o<strong>de</strong>r weniger breite Palette von<br />
Auslegungen, lässt aber an<strong>de</strong>re Auslegungen überhaupt nicht zu, weil <strong>de</strong>r Autor eine begrenzte<br />
Auswahl von Wörtern, Ausdrücken, rhetorischen Mitteln, poetischen Strategien und sprachlichen<br />
Strukturen benutzt hat, <strong>die</strong> <strong>de</strong>n Text bestimmen und <strong>de</strong>ssen Auslegung bedingen.<br />
Um <strong>die</strong>se komplexen Verhältnisse <strong>de</strong>r Textfaktoren zu klären, leistet uns <strong>de</strong>r scharfsichtige Umberto<br />
Eco 58 große Hilfe. Er unterschei<strong>de</strong>t einerseits <strong>de</strong>n „Realautor“, <strong>de</strong>n wirklichen Menschen,<br />
<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Text geschrieben hat, und an<strong>de</strong>rerseits <strong>de</strong>n „Mo<strong>de</strong>llautor“, <strong>de</strong>r eine textuelle Strategie<br />
ist, ein i<strong>de</strong>ales Bild, das direkt und ausschließlich aus <strong>de</strong>m Text selbst hervorgeht. An<strong>de</strong>re Theoretiker<br />
sehen <strong>die</strong>sen Unterschied ebenfalls: Der Mo<strong>de</strong>llautor wird von Wayne C. Booth 59 implied<br />
author genannt; Fernando Gómez Redondo 60 und Carlos Reis 61 nennen <strong>de</strong>n Realautor „autor“ und<br />
<strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>llautor „narrador“ (= Erzähler); Mario J. Valdés 62 nennt <strong>de</strong>n Realautor „escritor“ (=<br />
Schriftsteller) und <strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>llautor „autor“.<br />
Nach Eco darf man <strong>die</strong>se zwei Sorten Autoren niemals verwechseln. Den Mo<strong>de</strong>llautor gebe es<br />
notwendigerweise je<strong>de</strong>s Mal, wenn <strong>de</strong>r Text aktualisiert – d.h. gelesen – wird, <strong>de</strong>nn er sei ein<br />
Teil <strong>de</strong>r Textstruktur, <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Leser unbedingt brauche. Jenseits <strong>de</strong>s Textes aber könne <strong>de</strong>r Realautor<br />
das gemeint haben, was man aus seinem Text versteht, o<strong>de</strong>r aber genau das Gegenteil; auf<br />
je<strong>de</strong>n Fall sei <strong>die</strong>s keine Frage <strong>de</strong>r Literatur o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Linguistik, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Biografie o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
Geschichte. Die Figur <strong>de</strong>s Mo<strong>de</strong>llautors sei zwar nicht ganz objektiv zu bestimmen, <strong>de</strong>nn je<strong>de</strong>r<br />
Leser könne <strong>de</strong>n Text auf seine eigene Weise interpretieren, aber doch schon bis zu einem gewissen<br />
Punkt durch logische Inferenz objektivierbar 63 ; im Gegensatz dazu liege <strong>de</strong>r Bereich <strong>de</strong>s<br />
Realautors ganz ein<strong>de</strong>utig außerhalb <strong>de</strong>s literarischen Kommunikationsprozesses.<br />
55<br />
Hei<strong>de</strong>gger, 1959: 153.<br />
56<br />
Eagleton, 1988: 96.<br />
57<br />
Nünning, 2001: 277.<br />
58<br />
Sullà, 1996: 238 ff.<br />
59<br />
Sullà, 1996: 256 ff.<br />
60<br />
Gómez Redondo, 1994: 170 f.<br />
61<br />
Reis / Lopes, 1996: 26 f.<br />
62<br />
Valdés, 1989: 174.<br />
63<br />
Vgl. dazu auch Fokkema / Ibsch, 1988: 216 f.<br />
13