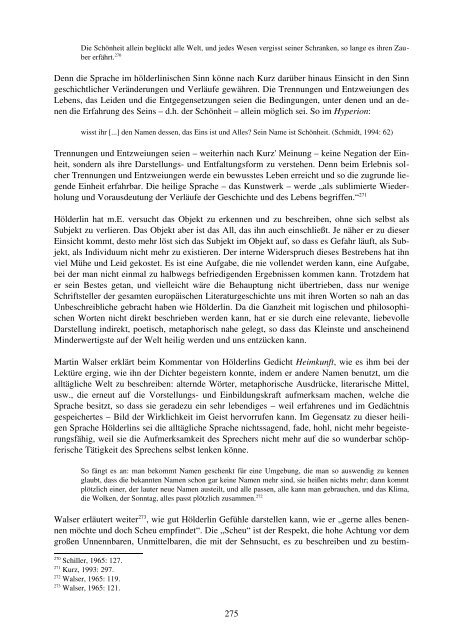die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Schönheit allein beglückt alle Welt, und je<strong>de</strong>s Wesen vergisst seiner Schranken, so lange es ihren Zauber<br />
erfährt. 270<br />
Denn <strong>die</strong> Sprache im höl<strong>de</strong>rlinischen Sinn könne nach Kurz darüber hinaus Einsicht in <strong>de</strong>n Sinn<br />
geschichtlicher Verän<strong>de</strong>rungen und Verläufe gewähren. Die Trennungen und Entzweiungen <strong>de</strong>s<br />
Lebens, das Lei<strong>de</strong>n und <strong>die</strong> Entgegensetzungen seien <strong>die</strong> Bedingungen, unter <strong>de</strong>nen und an <strong>de</strong>nen<br />
<strong>die</strong> Erfahrung <strong>de</strong>s Seins – d.h. <strong>de</strong>r Schönheit – allein möglich sei. So im Hyperion:<br />
wisst ihr [...] <strong>de</strong>n Namen <strong>de</strong>ssen, das Eins ist und Alles? Sein Name ist Schönheit. (Schmidt, 1994: 62)<br />
Trennungen und Entzweiungen seien – weiterhin nach Kurz' Meinung – keine Negation <strong>de</strong>r Einheit,<br />
son<strong>de</strong>rn als ihre Darstellungs und Entfaltungsform zu verstehen. Denn beim Erlebnis solcher<br />
Trennungen und Entzweiungen wer<strong>de</strong> ein bewusstes Leben erreicht und so <strong>die</strong> zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong><br />
Einheit erfahrbar. Die heilige Sprache – das Kunstwerk – wer<strong>de</strong> „als sublimierte Wie<strong>de</strong>rholung<br />
und Voraus<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Verläufe <strong>de</strong>r Geschichte und <strong>de</strong>s Lebens begriffen.“ 271<br />
Höl<strong>de</strong>rlin hat m.E. versucht das Objekt zu erkennen und zu beschreiben, ohne sich selbst als<br />
Subjekt zu verlieren. Das Objekt aber ist das All, das ihn auch einschließt. Je näher er zu <strong>die</strong>ser<br />
Einsicht kommt, <strong>de</strong>sto mehr löst sich das Subjekt im Objekt auf, so dass es Gefahr läuft, als Subjekt,<br />
als Individuum nicht mehr zu existieren. Der interne Wi<strong>de</strong>rspruch <strong>die</strong>ses Bestrebens hat ihn<br />
viel Mühe und Leid gekostet. Es ist eine Aufgabe, <strong>die</strong> nie vollen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n kann, eine Aufgabe,<br />
bei <strong>de</strong>r man nicht einmal zu halbwegs befriedigen<strong>de</strong>n Ergebnissen kommen kann. Trotz<strong>de</strong>m hat<br />
er sein Bestes getan, und vielleicht wäre <strong>die</strong> Behauptung nicht übertrieben, dass nur wenige<br />
Schriftsteller <strong>de</strong>r gesamten europäischen Literaturgeschichte uns mit ihren Worten so nah an das<br />
Unbeschreibliche gebracht haben wie Höl<strong>de</strong>rlin. Da <strong>die</strong> Ganzheit mit logischen und philosophischen<br />
Worten nicht direkt beschrieben wer<strong>de</strong>n kann, hat er sie durch eine relevante, liebevolle<br />
Darstellung indirekt, poetisch, metaphorisch nahe gelegt, so dass das Kleinste und anscheinend<br />
Min<strong>de</strong>rwertigste auf <strong>de</strong>r Welt heilig wer<strong>de</strong>n und uns entzücken kann.<br />
Martin Walser erklärt beim Kommentar von Höl<strong>de</strong>rlins Gedicht Heimkunft, wie es ihm bei <strong>de</strong>r<br />
Lektüre erging, wie ihn <strong>de</strong>r Dichter begeistern konnte, in<strong>de</strong>m er an<strong>de</strong>re Namen benutzt, um <strong>die</strong><br />
alltägliche Welt zu beschreiben: altern<strong>de</strong> Wörter, metaphorische Ausdrücke, literarische Mittel,<br />
usw., <strong>die</strong> erneut auf <strong>die</strong> Vorstellungs und Einbildungskraft aufmerksam machen, welche <strong>die</strong><br />
Sprache besitzt, so dass sie gera<strong>de</strong>zu ein sehr lebendiges – weil erfahrenes und im Gedächtnis<br />
gespeichertes – Bild <strong>de</strong>r Wirklichkeit im Geist hervorrufen kann. Im Gegensatz zu <strong>die</strong>ser heiligen<br />
Sprache Höl<strong>de</strong>rlins sei <strong>die</strong> alltägliche Sprache nichtssagend, fa<strong>de</strong>, hohl, nicht mehr begeisterungsfähig,<br />
weil sie <strong>die</strong> Aufmerksamkeit <strong>de</strong>s Sprechers nicht mehr auf <strong>die</strong> so wun<strong>de</strong>rbar schöpferische<br />
Tätigkeit <strong>de</strong>s Sprechens selbst lenken könne.<br />
So fängt es an: man bekommt Namen geschenkt für eine Umgebung, <strong>die</strong> man so auswendig zu kennen<br />
glaubt, dass <strong>die</strong> bekannten Namen schon gar keine Namen mehr sind, sie heißen nichts mehr; dann kommt<br />
plötzlich einer, <strong>de</strong>r lauter neue Namen austeilt, und alle passen, alle kann man gebrauchen, und das Klima,<br />
<strong>die</strong> Wolken, <strong>de</strong>r Sonntag, alles passt plötzlich zusammen. 272<br />
Walser erläutert weiter 273 , wie gut Höl<strong>de</strong>rlin Gefühle darstellen kann, wie er „gerne alles benennen<br />
möchte und doch Scheu empfin<strong>de</strong>t“. Die „Scheu“ ist <strong>de</strong>r Respekt, <strong>die</strong> hohe Achtung vor <strong>de</strong>m<br />
großen Unnennbaren, Unmittelbaren, <strong>die</strong> mit <strong>de</strong>r Sehnsucht, es zu beschreiben und zu bestim<br />
270<br />
Schiller, 1965: 127.<br />
271<br />
Kurz, 1993: 297.<br />
272<br />
Walser, 1965: 119.<br />
273<br />
Walser, 1965: 121.<br />
275