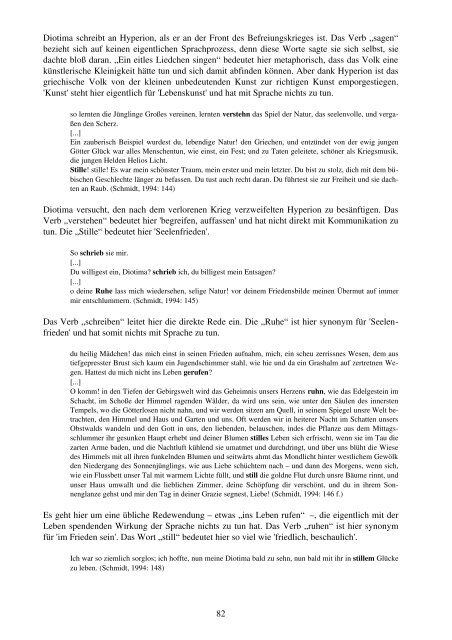die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Diotima schreibt an Hyperion, als er an <strong>de</strong>r Front <strong>de</strong>s Befreiungskrieges ist. Das Verb „sagen“<br />
bezieht sich auf keinen eigentlichen Sprachprozess, <strong>de</strong>nn <strong>die</strong>se Worte sagte sie sich selbst, sie<br />
dachte bloß daran. „Ein eitles Liedchen singen“ be<strong>de</strong>utet hier metaphorisch, dass das Volk eine<br />
künstlerische Kleinigkeit hätte tun und sich damit abfin<strong>de</strong>n können. Aber dank Hyperion ist das<br />
griechische Volk von <strong>de</strong>r kleinen unbe<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Kunst zur richtigen Kunst emporgestiegen.<br />
'Kunst' steht hier eigentlich für 'Lebenskunst' und hat mit Sprache nichts zu tun.<br />
so lernten <strong>die</strong> Jünglinge Großes vereinen, lernten verstehn das Spiel <strong>de</strong>r Natur, das seelenvolle, und vergaßen<br />
<strong>de</strong>n Scherz.<br />
[...]<br />
Ein zauberisch Beispiel wur<strong>de</strong>st du, lebendige Natur! <strong>de</strong>n Griechen, und entzün<strong>de</strong>t von <strong>de</strong>r ewig jungen<br />
Götter Glück war alles Menschentun, wie einst, ein Fest; und zu Taten geleitete, schöner als Kriegsmusik,<br />
<strong>die</strong> jungen Hel<strong>de</strong>n Helios Licht.<br />
Stille! stille! Es war mein schönster Traum, mein erster und mein letzter. Du bist zu stolz, dich mit <strong>de</strong>m bübischen<br />
Geschlechte länger zu befassen. Du tust auch recht daran. Du führtest sie zur Freiheit und sie dachten<br />
an Raub. (Schmidt, 1994: 144)<br />
Diotima versucht, <strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>m verlorenen Krieg verzweifelten Hyperion zu besänftigen. Das<br />
Verb „verstehen“ be<strong>de</strong>utet hier 'begreifen, auffassen' und hat nicht direkt mit Kommunikation zu<br />
tun. Die „Stille“ be<strong>de</strong>utet hier 'Seelenfrie<strong>de</strong>n'.<br />
So schrieb sie mir.<br />
[...]<br />
Du willigest ein, Diotima? schrieb ich, du billigest mein Entsagen?<br />
[...]<br />
o <strong>de</strong>ine Ruhe lass mich wie<strong>de</strong>rsehen, selige Natur! vor <strong>de</strong>inem Frie<strong>de</strong>nsbil<strong>de</strong> meinen Übermut auf immer<br />
mir entschlummern. (Schmidt, 1994: 145)<br />
Das Verb „schreiben“ leitet hier <strong>die</strong> direkte Re<strong>de</strong> ein. Die „Ruhe“ ist hier synonym für 'Seelenfrie<strong>de</strong>n'<br />
und hat somit nichts mit Sprache zu tun.<br />
du heilig Mädchen! das mich einst in seinen Frie<strong>de</strong>n aufnahm, mich, ein scheu zerrissnes Wesen, <strong>de</strong>m aus<br />
tiefgepresster Brust sich kaum ein Jugendschimmer stahl, wie hie und da ein Grashalm auf zertretnen Wegen.<br />
Hattest du mich nicht ins Leben gerufen?<br />
[...]<br />
O komm! in <strong>de</strong>n Tiefen <strong>de</strong>r Gebirgswelt wird das Geheimnis unsers Herzens ruhn, wie das E<strong>de</strong>lgestein im<br />
Schacht, im Schoße <strong>de</strong>r Himmel ragen<strong>de</strong>n Wäl<strong>de</strong>r, da wird uns sein, wie unter <strong>de</strong>n Säulen <strong>de</strong>s innersten<br />
Tempels, wo <strong>die</strong> Götterlosen nicht nahn, und wir wer<strong>de</strong>n sitzen am Quell, in seinem Spiegel unsre Welt betrachten,<br />
<strong>de</strong>n Himmel und Haus und Garten und uns. Oft wer<strong>de</strong>n wir in heiterer Nacht im Schatten unsers<br />
Obstwalds wan<strong>de</strong>ln und <strong>de</strong>n Gott in uns, <strong>de</strong>n lieben<strong>de</strong>n, belauschen, in<strong>de</strong>s <strong>die</strong> Pflanze aus <strong>de</strong>m Mittagsschlummer<br />
ihr gesunken Haupt erhebt und <strong>de</strong>iner Blumen stilles Leben sich erfrischt, wenn sie im Tau <strong>die</strong><br />
zarten Arme ba<strong>de</strong>n, und <strong>die</strong> Nachtluft kühlend sie umatmet und durchdringt, und über uns blüht <strong>die</strong> Wiese<br />
<strong>de</strong>s Himmels mit all ihren funkeln<strong>de</strong>n Blumen und seitwärts ahmt das Mondlicht hinter westlichem Gewölk<br />
<strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>s Sonnenjünglings, wie aus Liebe schüchtern nach – und dann <strong>de</strong>s Morgens, wenn sich,<br />
wie ein Flussbett unser Tal mit warmem Lichte füllt, und still <strong>die</strong> goldne Flut durch unsre Bäume rinnt, und<br />
unser Haus umwallt und <strong>die</strong> lieblichen Zimmer, <strong>de</strong>ine Schöpfung dir verschönt, und du in ihrem Sonnenglanze<br />
gehst und mir <strong>de</strong>n Tag in <strong>de</strong>iner Grazie segnest, Liebe! (Schmidt, 1994: 146 f.)<br />
Es geht hier um eine übliche Re<strong>de</strong>wendung – etwas „ins Leben rufen“ –, <strong>die</strong> eigentlich mit <strong>de</strong>r<br />
Leben spen<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Wirkung <strong>de</strong>r Sprache nichts zu tun hat. Das Verb „ruhen“ ist hier synonym<br />
für 'im Frie<strong>de</strong>n sein'. Das Wort „still“ be<strong>de</strong>utet hier so viel wie 'friedlich, beschaulich'.<br />
Ich war so ziemlich sorglos; ich hoffte, nun meine Diotima bald zu sehn, nun bald mit ihr in stillem Glücke<br />
zu leben. (Schmidt, 1994: 148)<br />
82