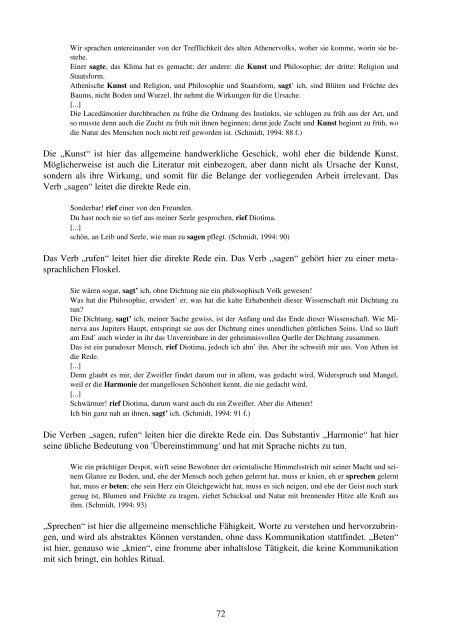die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wir sprachen untereinan<strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Trefflichkeit <strong>de</strong>s alten Athenervolks, woher sie komme, worin sie bestehe.<br />
Einer sagte, das Klima hat es gemacht; <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re: <strong>die</strong> Kunst und Philosophie; <strong>de</strong>r dritte: Religion und<br />
Staatsform.<br />
Athenische Kunst und Religion, und Philosophie und Staatsform, sagt’ ich, sind Blüten und Früchte <strong>de</strong>s<br />
Baums, nicht Bo<strong>de</strong>n und Wurzel. Ihr nehmt <strong>die</strong> Wirkungen für <strong>die</strong> Ursache.<br />
[...]<br />
Die Lacedämonier durchbrachen zu frühe <strong>die</strong> Ordnung <strong>de</strong>s Instinkts, sie schlugen zu früh aus <strong>de</strong>r Art, und<br />
so musste <strong>de</strong>nn auch <strong>die</strong> Zucht zu früh mit ihnen beginnen; <strong>de</strong>nn je<strong>de</strong> Zucht und Kunst beginnt zu früh, wo<br />
<strong>die</strong> Natur <strong>de</strong>s Menschen noch nicht reif gewor<strong>de</strong>n ist. (Schmidt, 1994: 88 f.)<br />
Die „Kunst“ ist hier das allgemeine handwerkliche Geschick, wohl eher <strong>die</strong> bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kunst.<br />
Möglicherweise ist auch <strong>die</strong> Literatur mit einbezogen, aber dann nicht als Ursache <strong>de</strong>r Kunst,<br />
son<strong>de</strong>rn als ihre Wirkung, und somit für <strong>die</strong> Belange <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit irrelevant. Das<br />
Verb „sagen“ leitet <strong>die</strong> direkte Re<strong>de</strong> ein.<br />
Son<strong>de</strong>rbar! rief einer von <strong>de</strong>n Freun<strong>de</strong>n.<br />
Du hast noch nie so tief aus meiner Seele gesprochen, rief Diotima.<br />
[...]<br />
schön, an Leib und Seele, wie man zu sagen pflegt. (Schmidt, 1994: 90)<br />
Das Verb „rufen“ leitet hier <strong>die</strong> direkte Re<strong>de</strong> ein. Das Verb „sagen“ gehört hier zu einer metasprachlichen<br />
Floskel.<br />
Sie wären sogar, sagt’ ich, ohne Dichtung nie ein philosophisch Volk gewesen!<br />
Was hat <strong>die</strong> Philosophie, erwi<strong>de</strong>rt’ er, was hat <strong>die</strong> kalte Erhabenheit <strong>die</strong>ser Wissenschaft mit Dichtung zu<br />
tun?<br />
Die Dichtung, sagt’ ich, meiner Sache gewiss, ist <strong>de</strong>r Anfang und das En<strong>de</strong> <strong>die</strong>ser Wissenschaft. Wie Minerva<br />
aus Jupiters Haupt, entspringt sie aus <strong>de</strong>r Dichtung eines unendlichen göttlichen Seins. Und so läuft<br />
am End’ auch wie<strong>de</strong>r in ihr das Unvereinbare in <strong>de</strong>r geheimnisvollen Quelle <strong>de</strong>r Dichtung zusammen.<br />
Das ist ein paradoxer Mensch, rief Diotima, jedoch ich ahn’ ihn. Aber ihr schweift mir aus. Von Athen ist<br />
<strong>die</strong> Re<strong>de</strong>.<br />
[...]<br />
Denn glaubt es mir, <strong>de</strong>r Zweifler fin<strong>de</strong>t darum nur in allem, was gedacht wird, Wi<strong>de</strong>rspruch und Mangel,<br />
weil er <strong>die</strong> Harmonie <strong>de</strong>r mangellosen Schönheit kennt, <strong>die</strong> nie gedacht wird.<br />
[...]<br />
Schwärmer! rief Diotima, darum warst auch du ein Zweifler. Aber <strong>die</strong> Athener!<br />
Ich bin ganz nah an ihnen, sagt’ ich. (Schmidt, 1994: 91 f.)<br />
Die Verben „sagen, rufen“ leiten hier <strong>die</strong> direkte Re<strong>de</strong> ein. Das Substantiv „Harmonie“ hat hier<br />
seine übliche Be<strong>de</strong>utung von 'Übereinstimmung' und hat mit Sprache nichts zu tun.<br />
Wie ein prächtiger Despot, wirft seine Bewohner <strong>de</strong>r orientalische Himmelsstrich mit seiner Macht und seinem<br />
Glanze zu Bo<strong>de</strong>n, und, ehe <strong>de</strong>r Mensch noch gehen gelernt hat, muss er knien, eh er sprechen gelernt<br />
hat, muss er beten; ehe sein Herz ein Gleichgewicht hat, muss es sich neigen, und ehe <strong>de</strong>r Geist noch stark<br />
genug ist, Blumen und Früchte zu tragen, ziehet Schicksal und Natur mit brennen<strong>de</strong>r Hitze alle Kraft aus<br />
ihm. (Schmidt, 1994: 93)<br />
„Sprechen“ ist hier <strong>die</strong> allgemeine menschliche Fähigkeit, Worte zu verstehen und hervorzubringen,<br />
und wird als abstraktes Können verstan<strong>de</strong>n, ohne dass Kommunikation stattfin<strong>de</strong>t. „Beten“<br />
ist hier, genauso wie „knien“, eine fromme aber inhaltslose Tätigkeit, <strong>die</strong> keine Kommunikation<br />
mit sich bringt, ein hohles Ritual.<br />
72