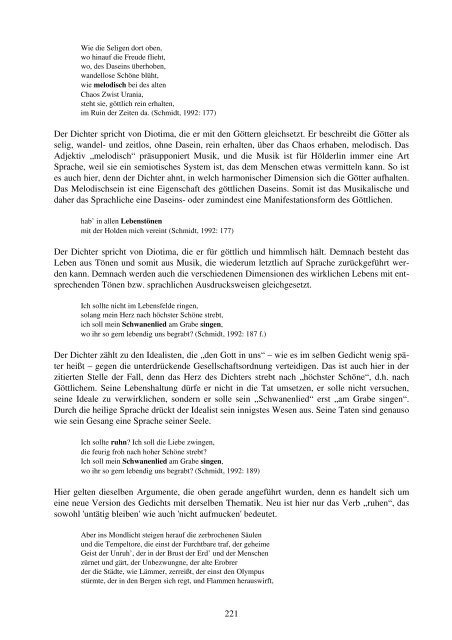die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wie <strong>die</strong> Seligen dort oben,<br />
wo hinauf <strong>die</strong> Freu<strong>de</strong> flieht,<br />
wo, <strong>de</strong>s Daseins überhoben,<br />
wan<strong>de</strong>llose Schöne blüht,<br />
wie melodisch bei <strong>de</strong>s alten<br />
Chaos Zwist Urania,<br />
steht sie, göttlich rein erhalten,<br />
im Ruin <strong>de</strong>r Zeiten da. (Schmidt, 1992: 177)<br />
Der Dichter spricht von Diotima, <strong>die</strong> er mit <strong>de</strong>n Göttern gleichsetzt. Er beschreibt <strong>die</strong> Götter als<br />
selig, wan<strong>de</strong>l und zeitlos, ohne Dasein, rein erhalten, über das Chaos erhaben, melodisch. Das<br />
Adjektiv „melodisch“ präsupponiert Musik, und <strong>die</strong> Musik ist für Höl<strong>de</strong>rlin immer eine Art<br />
Sprache, weil sie ein semiotisches System ist, das <strong>de</strong>m Menschen etwas vermitteln kann. So ist<br />
es auch hier, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Dichter ahnt, in welch harmonischer Dimension sich <strong>die</strong> Götter aufhalten.<br />
Das Melodischsein ist eine Eigenschaft <strong>de</strong>s göttlichen Daseins. Somit ist das Musikalische und<br />
daher das Sprachliche eine Daseins o<strong>de</strong>r zumin<strong>de</strong>st eine Manifestationsform <strong>de</strong>s Göttlichen.<br />
hab’ in allen Lebenstönen<br />
mit <strong>de</strong>r Hol<strong>de</strong>n mich vereint (Schmidt, 1992: 177)<br />
Der Dichter spricht von Diotima, <strong>die</strong> er für göttlich und himmlisch hält. Demnach besteht das<br />
Leben aus Tönen und somit aus Musik, <strong>die</strong> wie<strong>de</strong>rum letztlich auf Sprache zurückgeführt wer<strong>de</strong>n<br />
kann. Demnach wer<strong>de</strong>n auch <strong>die</strong> verschie<strong>de</strong>nen Dimensionen <strong>de</strong>s wirklichen Lebens mit entsprechen<strong>de</strong>n<br />
Tönen bzw. sprachlichen Ausdrucksweisen gleichgesetzt.<br />
Ich sollte nicht im Lebensfel<strong>de</strong> ringen,<br />
solang mein Herz nach höchster Schöne strebt,<br />
ich soll mein Schwanenlied am Grabe singen,<br />
wo ihr so gern lebendig uns begrabt? (Schmidt, 1992: 187 f.)<br />
Der Dichter zählt zu <strong>de</strong>n I<strong>de</strong>alisten, <strong>die</strong> „<strong>de</strong>n Gott in uns“ – wie es im selben Gedicht wenig später<br />
heißt – gegen <strong>die</strong> unterdrücken<strong>de</strong> Gesellschaftsordnung verteidigen. Das ist auch hier in <strong>de</strong>r<br />
zitierten Stelle <strong>de</strong>r Fall, <strong>de</strong>nn das Herz <strong>de</strong>s Dichters strebt nach „höchster Schöne“, d.h. nach<br />
Göttlichem. Seine Lebenshaltung dürfe er nicht in <strong>die</strong> Tat umsetzen, er solle nicht versuchen,<br />
seine I<strong>de</strong>ale zu verwirklichen, son<strong>de</strong>rn er solle sein „Schwanenlied“ erst „am Grabe singen“.<br />
Durch <strong>die</strong> heilige Sprache drückt <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>alist sein innigstes Wesen aus. Seine Taten sind genauso<br />
wie sein Gesang eine Sprache seiner Seele.<br />
Ich sollte ruhn? Ich soll <strong>die</strong> Liebe zwingen,<br />
<strong>die</strong> feurig froh nach hoher Schöne strebt?<br />
Ich soll mein Schwanenlied am Grabe singen,<br />
wo ihr so gern lebendig uns begrabt? (Schmidt, 1992: 189)<br />
Hier gelten <strong>die</strong>selben Argumente, <strong>die</strong> oben gera<strong>de</strong> angeführt wur<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn es han<strong>de</strong>lt sich um<br />
eine neue Version <strong>de</strong>s Gedichts mit <strong>de</strong>rselben Thematik. Neu ist hier nur das Verb „ruhen“, das<br />
sowohl 'untätig bleiben' wie auch 'nicht aufmucken' be<strong>de</strong>utet.<br />
Aber ins Mondlicht steigen herauf <strong>die</strong> zerbrochenen Säulen<br />
und <strong>die</strong> Tempeltore, <strong>die</strong> einst <strong>de</strong>r Furchtbare traf, <strong>de</strong>r geheime<br />
Geist <strong>de</strong>r Unruh’, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Brust <strong>de</strong>r Erd’ und <strong>de</strong>r Menschen<br />
zürnet und gärt, <strong>de</strong>r Unbezwungne, <strong>de</strong>r alte Erobrer<br />
<strong>de</strong>r <strong>die</strong> Städte, wie Lämmer, zerreißt, <strong>de</strong>r einst <strong>de</strong>n Olympus<br />
stürmte, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Bergen sich regt, und Flammen herauswirft,<br />
221