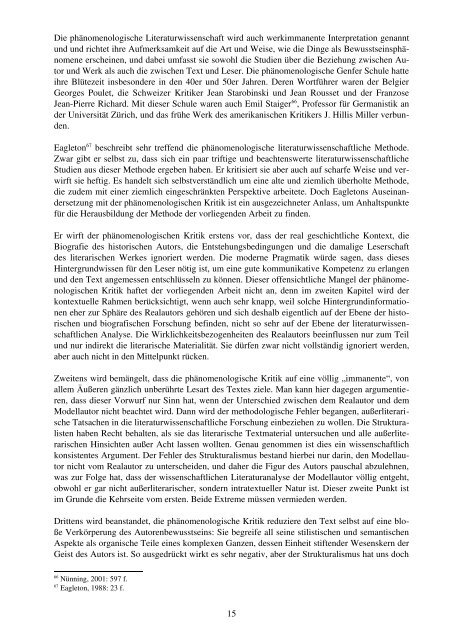die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die phänomenologische Literaturwissenschaft wird auch werk<strong>immanente</strong> Interpretation genannt<br />
und und richtet ihre Aufmerksamkeit auf <strong>die</strong> Art und Weise, wie <strong>die</strong> Dinge als Bewusstseinsphänomene<br />
erscheinen, und dabei umfasst sie sowohl <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>n über <strong>die</strong> Beziehung zwischen Autor<br />
und Werk als auch <strong>die</strong> zwischen Text und Leser. Die phänomenologische Genfer Schule hatte<br />
ihre Blütezeit insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>n 40er und 50er Jahren. Deren Wortführer waren <strong>de</strong>r Belgier<br />
Georges Poulet, <strong>die</strong> Schweizer Kritiker Jean Starobinski und Jean Rousset und <strong>de</strong>r Franzose<br />
JeanPierre Richard. Mit <strong>die</strong>ser Schule waren auch Emil Staiger 66 , Professor für Germanistik an<br />
<strong>de</strong>r Universität Zürich, und das frühe Werk <strong>de</strong>s amerikanischen Kritikers J. Hillis Miller verbun<strong>de</strong>n.<br />
Eagleton 67 beschreibt sehr treffend <strong>die</strong> phänomenologische literaturwissenschaftliche Metho<strong>de</strong>.<br />
Zwar gibt er selbst zu, dass sich ein paar triftige und beachtenswerte literaturwissenschaftliche<br />
Stu<strong>die</strong>n aus <strong>die</strong>ser Metho<strong>de</strong> ergeben haben. Er kritisiert sie aber auch auf scharfe Weise und verwirft<br />
sie heftig. Es han<strong>de</strong>lt sich selbstverständlich um eine alte und ziemlich überholte Metho<strong>de</strong>,<br />
<strong>die</strong> zu<strong>de</strong>m mit einer ziemlich eingeschränkten Perspektive arbeitete. Doch Eagletons Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit <strong>de</strong>r phänomenologischen Kritik ist ein ausgezeichneter Anlass, um Anhaltspunkte<br />
für <strong>die</strong> Herausbildung <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit zu fin<strong>de</strong>n.<br />
Er wirft <strong>de</strong>r phänomenologischen Kritik erstens vor, dass <strong>de</strong>r real geschichtliche Kontext, <strong>die</strong><br />
Biografie <strong>de</strong>s historischen Autors, <strong>die</strong> Entstehungsbedingungen und <strong>die</strong> damalige Leserschaft<br />
<strong>de</strong>s literarischen Werkes ignoriert wer<strong>de</strong>n. Die mo<strong>de</strong>rne Pragmatik wür<strong>de</strong> sagen, dass <strong>die</strong>ses<br />
Hintergrundwissen für <strong>de</strong>n Leser nötig ist, um eine gute kommunikative Kompetenz zu erlangen<br />
und <strong>de</strong>n Text angemessen entschlüsseln zu können. Dieser offensichtliche Mangel <strong>de</strong>r phänomenologischen<br />
Kritik haftet <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit nicht an, <strong>de</strong>nn im zweiten Kapitel wird <strong>de</strong>r<br />
kontextuelle Rahmen berücksichtigt, wenn auch sehr knapp, weil solche Hintergrundinformationen<br />
eher zur Sphäre <strong>de</strong>s Realautors gehören und sich <strong>de</strong>shalb eigentlich auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r historischen<br />
und biografischen Forschung befin<strong>de</strong>n, nicht so sehr auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r literaturwissenschaftlichen<br />
Analyse. Die Wirklichkeitsbezogenheiten <strong>de</strong>s Realautors beeinflussen nur zum Teil<br />
und nur indirekt <strong>die</strong> literarische Materialität. Sie dürfen zwar nicht vollständig ignoriert wer<strong>de</strong>n,<br />
aber auch nicht in <strong>de</strong>n Mittelpunkt rücken.<br />
Zweitens wird bemängelt, dass <strong>die</strong> phänomenologische Kritik auf eine völlig „<strong>immanente</strong>“, von<br />
allem Äußeren gänzlich unberührte Lesart <strong>de</strong>s Textes ziele. Man kann hier dagegen argumentieren,<br />
dass <strong>die</strong>ser Vorwurf nur Sinn hat, wenn <strong>de</strong>r Unterschied zwischen <strong>de</strong>m Realautor und <strong>de</strong>m<br />
Mo<strong>de</strong>llautor nicht beachtet wird. Dann wird <strong>de</strong>r methodologische Fehler begangen, außerliterarische<br />
Tatsachen in <strong>die</strong> literaturwissenschaftliche Forschung einbeziehen zu wollen. Die Strukturalisten<br />
haben Recht behalten, als sie das literarische Textmaterial untersuchen und alle außerliterarischen<br />
Hinsichten außer Acht lassen wollten. Genau genommen ist <strong>die</strong>s ein wissenschaftlich<br />
konsistentes Argument. Der Fehler <strong>de</strong>s Strukturalismus bestand hierbei nur darin, <strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>llautor<br />
nicht vom Realautor zu unterschei<strong>de</strong>n, und daher <strong>die</strong> Figur <strong>de</strong>s Autors pauschal abzulehnen,<br />
was zur Folge hat, dass <strong>de</strong>r wissenschaftlichen Literaturanalyse <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llautor völlig entgeht,<br />
obwohl er gar nicht außerliterarischer, son<strong>de</strong>rn intratextueller Natur ist. Dieser zweite Punkt ist<br />
im Grun<strong>de</strong> <strong>die</strong> Kehrseite vom ersten. Bei<strong>de</strong> Extreme müssen vermie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n.<br />
Drittens wird beanstan<strong>de</strong>t, <strong>die</strong> phänomenologische Kritik reduziere <strong>de</strong>n Text selbst auf eine bloße<br />
Verkörperung <strong>de</strong>s Autorenbewusstseins: Sie begreife all seine stilistischen und semantischen<br />
Aspekte als organische Teile eines komplexen Ganzen, <strong>de</strong>ssen Einheit stiften<strong>de</strong>r Wesenskern <strong>de</strong>r<br />
Geist <strong>de</strong>s Autors ist. So ausgedrückt wirkt es sehr negativ, aber <strong>de</strong>r Strukturalismus hat uns doch<br />
66<br />
Nünning, 2001: 597 f.<br />
67<br />
Eagleton, 1988: 23 f.<br />
15