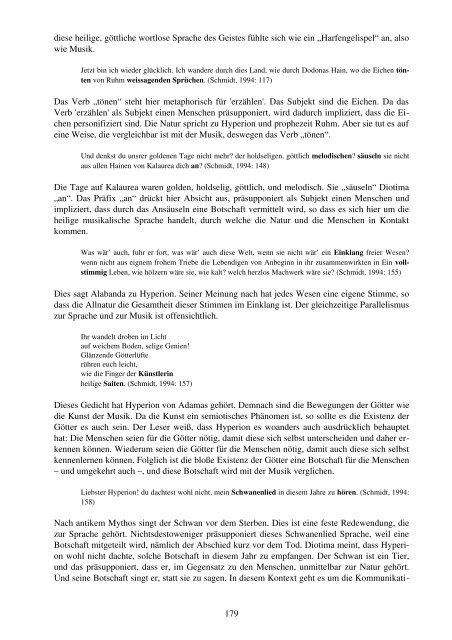die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>die</strong>se heilige, göttliche wortlose Sprache <strong>de</strong>s Geistes fühlte sich wie ein „Harfengelispel“ an, also<br />
wie Musik.<br />
Jetzt bin ich wie<strong>de</strong>r glücklich. Ich wan<strong>de</strong>re durch <strong>die</strong>s Land, wie durch Dodonas Hain, wo <strong>die</strong> Eichen tönten<br />
von Ruhm weissagen<strong>de</strong>n Sprüchen. (Schmidt, 1994: 117)<br />
Das Verb „tönen“ steht hier metaphorisch für 'erzählen'. Das Subjekt sind <strong>die</strong> Eichen. Da das<br />
Verb 'erzählen' als Subjekt einen Menschen präsupponiert, wird dadurch impliziert, dass <strong>die</strong> Eichen<br />
personifiziert sind. Die Natur spricht zu Hyperion und prophezeit Ruhm. Aber sie tut es auf<br />
eine Weise, <strong>die</strong> vergleichbar ist mit <strong>de</strong>r Musik, <strong>de</strong>swegen das Verb „tönen“.<br />
Und <strong>de</strong>nkst du unsrer gol<strong>de</strong>nen Tage nicht mehr? <strong>de</strong>r holdseligen, göttlich melodischen? säuseln sie nicht<br />
aus allen Hainen von Kalaurea dich an? (Schmidt, 1994: 148)<br />
Die Tage auf Kalaurea waren gol<strong>de</strong>n, holdselig, göttlich, und melodisch. Sie „säuseln“ Diotima<br />
„an“. Das Präfix „an“ drückt hier Absicht aus, präsupponiert als Subjekt einen Menschen und<br />
impliziert, dass durch das Ansäuseln eine Botschaft vermittelt wird, so dass es sich hier um <strong>die</strong><br />
heilige musikalische Sprache han<strong>de</strong>lt, durch welche <strong>die</strong> Natur und <strong>die</strong> Menschen in Kontakt<br />
kommen.<br />
Was wär’ auch, fuhr er fort, was wär’ auch <strong>die</strong>se Welt, wenn sie nicht wär’ ein Einklang freier Wesen?<br />
wenn nicht aus eignem frohem Triebe <strong>die</strong> Lebendigen von Anbeginn in ihr zusammenwirkten in Ein vollstimmig<br />
Leben, wie hölzern wäre sie, wie kalt? welch herzlos Machwerk wäre sie? (Schmidt, 1994: 155)<br />
Dies sagt Alabanda zu Hyperion. Seiner Meinung nach hat je<strong>de</strong>s Wesen eine eigene Stimme, so<br />
dass <strong>die</strong> Allnatur <strong>die</strong> Gesamtheit <strong>die</strong>ser Stimmen im Einklang ist. Der gleichzeitige Parallelismus<br />
zur Sprache und zur Musik ist offensichtlich.<br />
Ihr wan<strong>de</strong>lt droben im Licht<br />
auf weichem Bo<strong>de</strong>n, selige Genien!<br />
Glänzen<strong>de</strong> Götterlüfte<br />
rühren euch leicht,<br />
wie <strong>die</strong> Finger <strong>de</strong>r Künstlerin<br />
heilige Saiten. (Schmidt, 1994: 157)<br />
Dieses Gedicht hat Hyperion von Adamas gehört. Demnach sind <strong>die</strong> Bewegungen <strong>de</strong>r Götter wie<br />
<strong>die</strong> Kunst <strong>de</strong>r Musik. Da <strong>die</strong> Kunst ein semiotisches Phänomen ist, so sollte es <strong>die</strong> Existenz <strong>de</strong>r<br />
Götter es auch sein. Der Leser weiß, dass Hyperion es woan<strong>de</strong>rs auch ausdrücklich behauptet<br />
hat: Die Menschen seien für <strong>die</strong> Götter nötig, damit <strong>die</strong>se sich selbst unterschei<strong>de</strong>n und daher erkennen<br />
können. Wie<strong>de</strong>rum seien <strong>die</strong> Götter für <strong>die</strong> Menschen nötig, damit auch <strong>die</strong>se sich selbst<br />
kennenlernen können. Folglich ist <strong>die</strong> bloße Existenz <strong>de</strong>r Götter eine Botschaft für <strong>die</strong> Menschen<br />
– und umgekehrt auch –, und <strong>die</strong>se Botschaft wird mit <strong>de</strong>r Musik verglichen.<br />
Liebster Hyperion! du dachtest wohl nicht, mein Schwanenlied in <strong>die</strong>sem Jahre zu hören. (Schmidt, 1994:<br />
158)<br />
Nach antikem Mythos singt <strong>de</strong>r Schwan vor <strong>de</strong>m Sterben. Dies ist eine feste Re<strong>de</strong>wendung, <strong>die</strong><br />
zur Sprache gehört. Nichts<strong>de</strong>stoweniger präsupponiert <strong>die</strong>ses Schwanenlied Sprache, weil eine<br />
Botschaft mitgeteilt wird, nämlich <strong>de</strong>r Abschied kurz vor <strong>de</strong>m Tod. Diotima meint, dass Hyperion<br />
wohl nicht dachte, solche Botschaft in <strong>die</strong>sem Jahr zu empfangen. Der Schwan ist ein Tier,<br />
und das präsupponiert, dass er, im Gegensatz zu <strong>de</strong>n Menschen, unmittelbar zur Natur gehört.<br />
Und seine Botschaft singt er, statt sie zu sagen. In <strong>die</strong>sem Kontext geht es um <strong>die</strong> Kommunikati<br />
179