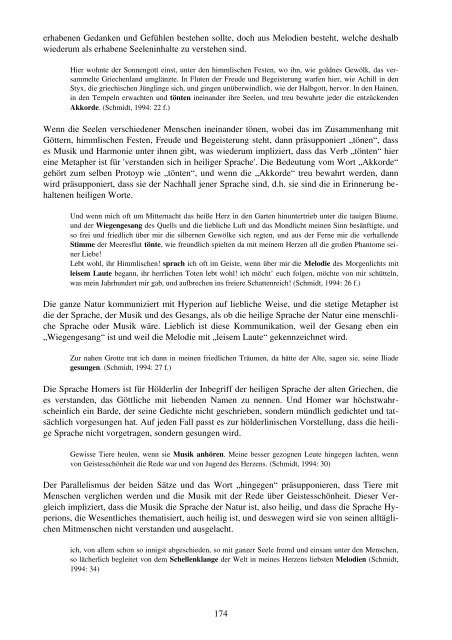die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
erhabenen Gedanken und Gefühlen bestehen sollte, doch aus Melo<strong>die</strong>n besteht, welche <strong>de</strong>shalb<br />
wie<strong>de</strong>rum als erhabene Seeleninhalte zu verstehen sind.<br />
Hier wohnte <strong>de</strong>r Sonnengott einst, unter <strong>de</strong>n himmlischen Festen, wo ihn, wie goldnes Gewölk, das versammelte<br />
Griechenland umglänzte. In Fluten <strong>de</strong>r Freu<strong>de</strong> und Begeisterung warfen hier, wie Achill in <strong>de</strong>n<br />
Styx, <strong>die</strong> griechischen Jünglinge sich, und gingen unüberwindlich, wie <strong>de</strong>r Halbgott, hervor. In <strong>de</strong>n Hainen,<br />
in <strong>de</strong>n Tempeln erwachten und tönten ineinan<strong>de</strong>r ihre Seelen, und treu bewahrte je<strong>de</strong>r <strong>die</strong> entzücken<strong>de</strong>n<br />
Akkor<strong>de</strong>. (Schmidt, 1994: 22 f.)<br />
Wenn <strong>die</strong> Seelen verschie<strong>de</strong>ner Menschen ineinan<strong>de</strong>r tönen, wobei das im Zusammenhang mit<br />
Göttern, himmlischen Festen, Freu<strong>de</strong> und Begeisterung steht, dann präsupponiert „tönen“, dass<br />
es Musik und Harmonie unter ihnen gibt, was wie<strong>de</strong>rum impliziert, dass das Verb „tönten“ hier<br />
eine Metapher ist für 'verstan<strong>de</strong>n sich in heiliger Sprache'. Die Be<strong>de</strong>utung vom Wort „Akkor<strong>de</strong>“<br />
gehört zum selben Protoyp wie „tönten“, und wenn <strong>die</strong> „Akkor<strong>de</strong>“ treu bewahrt wer<strong>de</strong>n, dann<br />
wird präsupponiert, dass sie <strong>de</strong>r Nachhall jener Sprache sind, d.h. sie sind <strong>die</strong> in Erinnerung behaltenen<br />
heiligen Worte.<br />
Und wenn mich oft um Mitternacht das heiße Herz in <strong>de</strong>n Garten hinuntertrieb unter <strong>die</strong> tauigen Bäume,<br />
und <strong>de</strong>r Wiegengesang <strong>de</strong>s Quells und <strong>die</strong> liebliche Luft und das Mondlicht meinen Sinn besänftigte, und<br />
so frei und friedlich über mir <strong>die</strong> silbernen Gewölke sich regten, und aus <strong>de</strong>r Ferne mir <strong>die</strong> verhallen<strong>de</strong><br />
Stimme <strong>de</strong>r Meeresflut tönte, wie freundlich spielten da mit meinem Herzen all <strong>die</strong> großen Phantome seiner<br />
Liebe!<br />
Lebt wohl, ihr Himmlischen! sprach ich oft im Geiste, wenn über mir <strong>die</strong> Melo<strong>die</strong> <strong>de</strong>s Morgenlichts mit<br />
leisem Laute begann, ihr herrlichen Toten lebt wohl! ich möcht’ euch folgen, möchte von mir schütteln,<br />
was mein Jahrhun<strong>de</strong>rt mir gab, und aufbrechen ins freiere Schattenreich! (Schmidt, 1994: 26 f.)<br />
Die ganze Natur kommuniziert mit Hyperion auf liebliche Weise, und <strong>die</strong> stetige Metapher ist<br />
<strong>die</strong> <strong>de</strong>r Sprache, <strong>de</strong>r Musik und <strong>de</strong>s Gesangs, als ob <strong>die</strong> heilige Sprache <strong>de</strong>r Natur eine menschliche<br />
Sprache o<strong>de</strong>r Musik wäre. Lieblich ist <strong>die</strong>se Kommunikation, weil <strong>de</strong>r Gesang eben ein<br />
„Wiegengesang“ ist und weil <strong>die</strong> Melo<strong>die</strong> mit „leisem Laute“ gekennzeichnet wird.<br />
Zur nahen Grotte trat ich dann in meinen friedlichen Träumen, da hätte <strong>de</strong>r Alte, sagen sie, seine Ilia<strong>de</strong><br />
gesungen. (Schmidt, 1994: 27 f.)<br />
Die Sprache Homers ist für Höl<strong>de</strong>rlin <strong>de</strong>r Inbegriff <strong>de</strong>r heiligen Sprache <strong>de</strong>r alten Griechen, <strong>die</strong><br />
es verstan<strong>de</strong>n, das Göttliche mit lieben<strong>de</strong>n Namen zu nennen. Und Homer war höchstwahrscheinlich<br />
ein Bar<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r seine Gedichte nicht geschrieben, son<strong>de</strong>rn mündlich gedichtet und tatsächlich<br />
vorgesungen hat. Auf je<strong>de</strong>n Fall passt es zur höl<strong>de</strong>rlinischen Vorstellung, dass <strong>die</strong> heilige<br />
Sprache nicht vorgetragen, son<strong>de</strong>rn gesungen wird.<br />
Gewisse Tiere heulen, wenn sie Musik anhören. Meine besser gezognen Leute hingegen lachten, wenn<br />
von Geistesschönheit <strong>die</strong> Re<strong>de</strong> war und von Jugend <strong>de</strong>s Herzens. (Schmidt, 1994: 30)<br />
Der Parallelismus <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Sätze und das Wort „hingegen“ präsupponieren, dass Tiere mit<br />
Menschen verglichen wer<strong>de</strong>n und <strong>die</strong> Musik mit <strong>de</strong>r Re<strong>de</strong> über Geistesschönheit. Dieser Vergleich<br />
impliziert, dass <strong>die</strong> Musik <strong>die</strong> Sprache <strong>de</strong>r Natur ist, also heilig, und dass <strong>die</strong> Sprache Hyperions,<br />
<strong>die</strong> Wesentliches thematisiert, auch heilig ist, und <strong>de</strong>swegen wird sie von seinen alltäglichen<br />
Mitmenschen nicht verstan<strong>de</strong>n und ausgelacht.<br />
ich, von allem schon so innigst abgeschie<strong>de</strong>n, so mit ganzer Seele fremd und einsam unter <strong>de</strong>n Menschen,<br />
so lächerlich begleitet von <strong>de</strong>m Schellenklange <strong>de</strong>r Welt in meines Herzens liebsten Melo<strong>die</strong>n (Schmidt,<br />
1994: 34)<br />
174