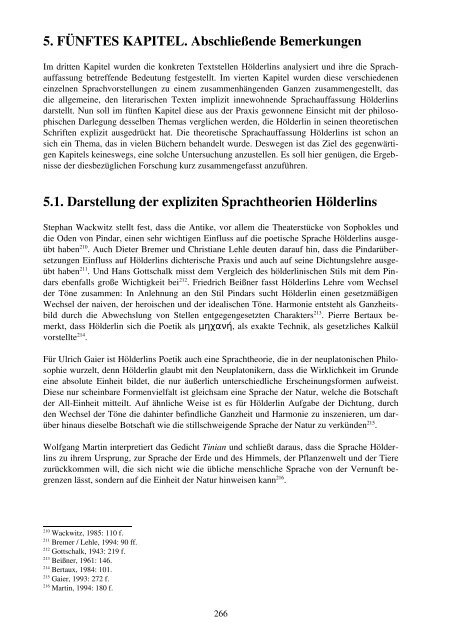die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5. FÜNFTES KAPITEL. Abschließen<strong>de</strong> Bemerkungen<br />
Im dritten Kapitel wur<strong>de</strong>n <strong>die</strong> konkreten Textstellen Höl<strong>de</strong>rlins analysiert und ihre <strong>die</strong> Sprachauffassung<br />
betreffen<strong>de</strong> Be<strong>de</strong>utung festgestellt. Im vierten Kapitel wur<strong>de</strong>n <strong>die</strong>se verschie<strong>de</strong>nen<br />
einzelnen Sprachvorstellungen zu einem zusammenhängen<strong>de</strong>n Ganzen zusammengestellt, das<br />
<strong>die</strong> allgemeine, <strong>de</strong>n literarischen Texten implizit innewohnen<strong>de</strong> Sprachauffassung Höl<strong>de</strong>rlins<br />
darstellt. Nun soll im fünften Kapitel <strong>die</strong>se aus <strong>de</strong>r Praxis gewonnene Einsicht mit <strong>de</strong>r philosophischen<br />
Darlegung <strong>de</strong>sselben Themas verglichen wer<strong>de</strong>n, <strong>die</strong> Höl<strong>de</strong>rlin in seinen theoretischen<br />
Schriften explizit ausgedrückt hat. Die theoretische Sprachauffassung Höl<strong>de</strong>rlins ist schon an<br />
sich ein Thema, das in vielen Büchern behan<strong>de</strong>lt wur<strong>de</strong>. Deswegen ist das Ziel <strong>de</strong>s gegenwärtigen<br />
Kapitels keineswegs, eine solche Untersuchung anzustellen. Es soll hier genügen, <strong>die</strong> Ergebnisse<br />
<strong>de</strong>r <strong>die</strong>sbezüglichen Forschung kurz zusammengefasst anzuführen.<br />
5.1. Darstellung <strong>de</strong>r expliziten Sprachtheorien Höl<strong>de</strong>rlins<br />
Stephan Wackwitz stellt fest, dass <strong>die</strong> Antike, vor allem <strong>die</strong> Theaterstücke von Sophokles und<br />
<strong>die</strong> O<strong>de</strong>n von Pindar, einen sehr wichtigen Einfluss auf <strong>die</strong> poetische Sprache Höl<strong>de</strong>rlins ausgeübt<br />
haben 210 . Auch Dieter Bremer und Christiane Lehle <strong>de</strong>uten darauf hin, dass <strong>die</strong> Pindarübersetzungen<br />
Einfluss auf Höl<strong>de</strong>rlins dichterische Praxis und auch auf seine Dichtungslehre ausgeübt<br />
haben 211 . Und Hans Gottschalk misst <strong>de</strong>m Vergleich <strong>de</strong>s höl<strong>de</strong>rlinischen Stils mit <strong>de</strong>m Pindars<br />
ebenfalls große Wichtigkeit bei 212 . Friedrich Beißner fasst Höl<strong>de</strong>rlins Lehre vom Wechsel<br />
<strong>de</strong>r Töne zusammen: In Anlehnung an <strong>de</strong>n Stil Pindars sucht Höl<strong>de</strong>rlin einen gesetzmäßigen<br />
Wechsel <strong>de</strong>r naiven, <strong>de</strong>r heroischen und <strong>de</strong>r i<strong>de</strong>alischen Töne. Harmonie entsteht als Ganzheitsbild<br />
durch <strong>die</strong> Abwechslung von Stellen entgegengesetzten Charakters 213 . Pierre Bertaux bemerkt,<br />
dass Höl<strong>de</strong>rlin sich <strong>die</strong> Poetik als μηχανή, als exakte Technik, als gesetzliches Kalkül<br />
vorstellte 214 .<br />
Für Ulrich Gaier ist Höl<strong>de</strong>rlins Poetik auch eine Sprachtheorie, <strong>die</strong> in <strong>de</strong>r neuplatonischen Philosophie<br />
wurzelt, <strong>de</strong>nn Höl<strong>de</strong>rlin glaubt mit <strong>de</strong>n Neuplatonikern, dass <strong>die</strong> Wirklichkeit im Grun<strong>de</strong><br />
eine absolute Einheit bil<strong>de</strong>t, <strong>die</strong> nur äußerlich unterschiedliche Erscheinungsformen aufweist.<br />
Diese nur scheinbare Formenvielfalt ist gleichsam eine Sprache <strong>de</strong>r Natur, welche <strong>die</strong> Botschaft<br />
<strong>de</strong>r AllEinheit mitteilt. Auf ähnliche Weise ist es für Höl<strong>de</strong>rlin Aufgabe <strong>de</strong>r Dichtung, durch<br />
<strong>de</strong>n Wechsel <strong>de</strong>r Töne <strong>die</strong> dahinter befindliche Ganzheit und Harmonie zu inszenieren, um darüber<br />
hinaus <strong>die</strong>selbe Botschaft wie <strong>die</strong> stillschweigen<strong>de</strong> Sprache <strong>de</strong>r Natur zu verkün<strong>de</strong>n 215 .<br />
Wolfgang Martin interpretiert das Gedicht Tinian und schließt daraus, dass <strong>die</strong> Sprache Höl<strong>de</strong>rlins<br />
zu ihrem Ursprung, zur Sprache <strong>de</strong>r Er<strong>de</strong> und <strong>de</strong>s Himmels, <strong>de</strong>r Pflanzenwelt und <strong>de</strong>r Tiere<br />
zurückkommen will, <strong>die</strong> sich nicht wie <strong>die</strong> übliche menschliche Sprache von <strong>de</strong>r Vernunft begrenzen<br />
lässt, son<strong>de</strong>rn auf <strong>die</strong> Einheit <strong>de</strong>r Natur hinweisen kann 216 .<br />
210<br />
Wackwitz, 1985: 110 f.<br />
211<br />
Bremer / Lehle, 1994: 90 ff.<br />
212<br />
Gottschalk, 1943: 219 f.<br />
213<br />
Beißner, 1961: 146.<br />
214<br />
Bertaux, 1984: 101.<br />
215<br />
Gaier, 1993: 272 f.<br />
216<br />
Martin, 1994: 180 f.<br />
266