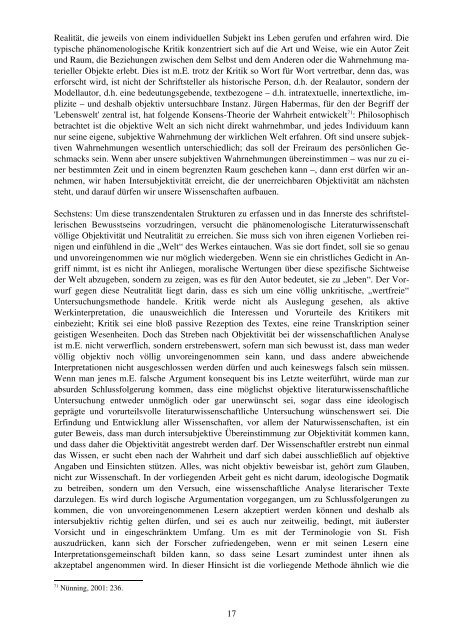die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Realität, <strong>die</strong> jeweils von einem individuellen Subjekt ins Leben gerufen und erfahren wird. Die<br />
typische phänomenologische Kritik konzentriert sich auf <strong>die</strong> Art und Weise, wie ein Autor Zeit<br />
und Raum, <strong>die</strong> Beziehungen zwischen <strong>de</strong>m Selbst und <strong>de</strong>m An<strong>de</strong>ren o<strong>de</strong>r <strong>die</strong> Wahrnehmung materieller<br />
Objekte erlebt. Dies ist m.E. trotz <strong>de</strong>r Kritik so Wort für Wort vertretbar, <strong>de</strong>nn das, was<br />
erforscht wird, ist nicht <strong>de</strong>r Schriftsteller als historische Person, d.h. <strong>de</strong>r Realautor, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r<br />
Mo<strong>de</strong>llautor, d.h. eine be<strong>de</strong>utungsgeben<strong>de</strong>, textbezogene – d.h. intratextuelle, innertextliche, implizite<br />
– und <strong>de</strong>shalb objektiv untersuchbare Instanz. Jürgen Habermas, für <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>r<br />
'Lebenswelt' zentral ist, hat folgen<strong>de</strong> KonsensTheorie <strong>de</strong>r Wahrheit entwickelt 71 : Philosophisch<br />
betrachtet ist <strong>die</strong> objektive Welt an sich nicht direkt wahrnehmbar, und je<strong>de</strong>s Individuum kann<br />
nur seine eigene, subjektive Wahrnehmung <strong>de</strong>r wirklichen Welt erfahren. Oft sind unsere subjektiven<br />
Wahrnehmungen wesentlich unterschiedlich; das soll <strong>de</strong>r Freiraum <strong>de</strong>s persönlichen Geschmacks<br />
sein. Wenn aber unsere subjektiven Wahrnehmungen übereinstimmen – was nur zu einer<br />
bestimmten Zeit und in einem begrenzten Raum geschehen kann –, dann erst dürfen wir annehmen,<br />
wir haben Intersubjektivität erreicht, <strong>die</strong> <strong>de</strong>r unerreichbaren Objektivität am nächsten<br />
steht, und darauf dürfen wir unsere Wissenschaften aufbauen.<br />
Sechstens: Um <strong>die</strong>se transzen<strong>de</strong>ntalen Strukturen zu erfassen und in das Innerste <strong>de</strong>s schriftstellerischen<br />
Bewusstseins vorzudringen, versucht <strong>die</strong> phänomenologische Literaturwissenschaft<br />
völlige Objektivität und Neutralität zu erreichen. Sie muss sich von ihren eigenen Vorlieben reinigen<br />
und einfühlend in <strong>die</strong> „Welt“ <strong>de</strong>s Werkes eintauchen. Was sie dort fin<strong>de</strong>t, soll sie so genau<br />
und unvoreingenommen wie nur möglich wie<strong>de</strong>rgeben. Wenn sie ein christliches Gedicht in Angriff<br />
nimmt, ist es nicht ihr Anliegen, moralische Wertungen über <strong>die</strong>se spezifische Sichtweise<br />
<strong>de</strong>r Welt abzugeben, son<strong>de</strong>rn zu zeigen, was es für <strong>de</strong>n Autor be<strong>de</strong>utet, sie zu „leben“. Der Vorwurf<br />
gegen <strong>die</strong>se Neutralität liegt darin, dass es sich um eine völlig unkritische, „wertfreie“<br />
Untersuchungsmetho<strong>de</strong> han<strong>de</strong>le. Kritik wer<strong>de</strong> nicht als Auslegung gesehen, als aktive<br />
Werkinterpretation, <strong>die</strong> unausweichlich <strong>die</strong> Interessen und Vorurteile <strong>de</strong>s Kritikers mit<br />
einbezieht; Kritik sei eine bloß passive Rezeption <strong>de</strong>s Textes, eine reine Transkription seiner<br />
geistigen Wesenheiten. Doch das Streben nach Objektivität bei <strong>de</strong>r wissenschaftlichen Analyse<br />
ist m.E. nicht verwerflich, son<strong>de</strong>rn erstrebenswert, sofern man sich bewusst ist, dass man we<strong>de</strong>r<br />
völlig objektiv noch völlig unvoreingenommen sein kann, und dass an<strong>de</strong>re abweichen<strong>de</strong><br />
Interpretationen nicht ausgeschlossen wer<strong>de</strong>n dürfen und auch keineswegs falsch sein müssen.<br />
Wenn man jenes m.E. falsche Argument konsequent bis ins Letzte weiterführt, wür<strong>de</strong> man zur<br />
absur<strong>de</strong>n Schlussfolgerung kommen, dass eine möglichst objektive literaturwissenschaftliche<br />
Untersuchung entwe<strong>de</strong>r unmöglich o<strong>de</strong>r gar unerwünscht sei, sogar dass eine i<strong>de</strong>ologisch<br />
geprägte und vorurteilsvolle literaturwissenschaftliche Untersuchung wünschenswert sei. Die<br />
Erfindung und Entwicklung aller Wissenschaften, vor allem <strong>de</strong>r Naturwissenschaften, ist ein<br />
guter Beweis, dass man durch intersubjektive Übereinstimmung zur Objektivität kommen kann,<br />
und dass daher <strong>die</strong> Objektivität angestrebt wer<strong>de</strong>n darf. Der Wissenschaftler erstrebt nun einmal<br />
das Wissen, er sucht eben nach <strong>de</strong>r Wahrheit und darf sich dabei ausschließlich auf objektive<br />
Angaben und Einsichten stützen. Alles, was nicht objektiv beweisbar ist, gehört zum Glauben,<br />
nicht zur Wissenschaft. In <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit geht es nicht darum, i<strong>de</strong>ologische Dogmatik<br />
zu betreiben, son<strong>de</strong>rn um <strong>de</strong>n Versuch, eine wissenschaftliche Analyse literarischer Texte<br />
darzulegen. Es wird durch logische Argumentation vorgegangen, um zu Schlussfolgerungen zu<br />
kommen, <strong>die</strong> von unvoreingenommenen Lesern akzeptiert wer<strong>de</strong>n können und <strong>de</strong>shalb als<br />
intersubjektiv richtig gelten dürfen, und sei es auch nur zeitweilig, bedingt, mit äußerster<br />
Vorsicht und in eingeschränktem Umfang. Um es mit <strong>de</strong>r Terminologie von St. Fish<br />
auszudrücken, kann sich <strong>de</strong>r Forscher zufrie<strong>de</strong>ngeben, wenn er mit seinen Lesern eine<br />
Interpretationsgemeinschaft bil<strong>de</strong>n kann, so dass seine Lesart zumin<strong>de</strong>st unter ihnen als<br />
akzeptabel angenommen wird. In <strong>die</strong>ser Hinsicht ist <strong>die</strong> vorliegen<strong>de</strong> Metho<strong>de</strong> ähnlich wie <strong>die</strong><br />
71<br />
Nünning, 2001: 236.<br />
17