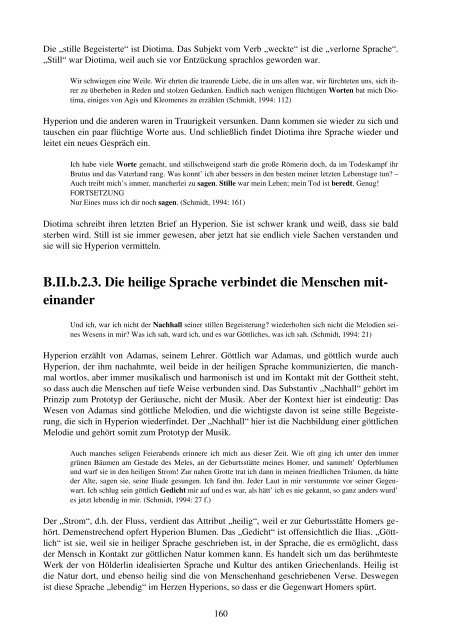die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die „stille Begeisterte“ ist Diotima. Das Subjekt vom Verb „weckte“ ist <strong>die</strong> „verlorne Sprache“.<br />
„Still“ war Diotima, weil auch sie vor Entzückung sprachlos gewor<strong>de</strong>n war.<br />
Wir schwiegen eine Weile. Wir ehrten <strong>die</strong> trauren<strong>de</strong> Liebe, <strong>die</strong> in uns allen war, wir fürchteten uns, sich ihrer<br />
zu überheben in Re<strong>de</strong>n und stolzen Gedanken. Endlich nach wenigen flüchtigen Worten bat mich Diotima,<br />
einiges von Agis und Kleomenes zu erzählen (Schmidt, 1994: 112)<br />
Hyperion und <strong>die</strong> an<strong>de</strong>ren waren in Traurigkeit versunken. Dann kommen sie wie<strong>de</strong>r zu sich und<br />
tauschen ein paar flüchtige Worte aus. Und schließlich fin<strong>de</strong>t Diotima ihre Sprache wie<strong>de</strong>r und<br />
leitet ein neues Gespräch ein.<br />
Ich habe viele Worte gemacht, und stillschweigend starb <strong>die</strong> große Römerin doch, da im To<strong>de</strong>skampf ihr<br />
Brutus und das Vaterland rang. Was konnt’ ich aber bessers in <strong>de</strong>n besten meiner letzten Lebenstage tun? –<br />
Auch treibt mich’s immer, mancherlei zu sagen. Stille war mein Leben; mein Tod ist beredt. Genug!<br />
FORTSETZUNG<br />
Nur Eines muss ich dir noch sagen. (Schmidt, 1994: 161)<br />
Diotima schreibt ihren letzten Brief an Hyperion. Sie ist schwer krank und weiß, dass sie bald<br />
sterben wird. Still ist sie immer gewesen, aber jetzt hat sie endlich viele Sachen verstan<strong>de</strong>n und<br />
sie will sie Hyperion vermitteln.<br />
B.II.b.2.3. Die heilige Sprache verbin<strong>de</strong>t <strong>die</strong> Menschen miteinan<strong>de</strong>r<br />
Und ich, war ich nicht <strong>de</strong>r Nachhall seiner stillen Begeisterung? wie<strong>de</strong>rholten sich nicht <strong>die</strong> Melo<strong>die</strong>n seines<br />
Wesens in mir? Was ich sah, ward ich, und es war Göttliches, was ich sah. (Schmidt, 1994: 21)<br />
Hyperion erzählt von Adamas, seinem Lehrer. Göttlich war Adamas, und göttlich wur<strong>de</strong> auch<br />
Hyperion, <strong>de</strong>r ihm nachahmte, weil bei<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r heiligen Sprache kommunizierten, <strong>die</strong> manchmal<br />
wortlos, aber immer musikalisch und harmonisch ist und im Kontakt mit <strong>de</strong>r Gottheit steht,<br />
so dass auch <strong>die</strong> Menschen auf tiefe Weise verbun<strong>de</strong>n sind. Das Substantiv „Nachhall“ gehört im<br />
Prinzip zum Prototyp <strong>de</strong>r Geräusche, nicht <strong>de</strong>r Musik. Aber <strong>de</strong>r Kontext hier ist ein<strong>de</strong>utig: Das<br />
Wesen von Adamas sind göttliche Melo<strong>die</strong>n, und <strong>die</strong> wichtigste davon ist seine stille Begeisterung,<br />
<strong>die</strong> sich in Hyperion wie<strong>de</strong>rfin<strong>de</strong>t. Der „Nachhall“ hier ist <strong>die</strong> Nachbildung einer göttlichen<br />
Melo<strong>die</strong> und gehört somit zum Prototyp <strong>de</strong>r Musik.<br />
Auch manches seligen Feierabends erinnere ich mich aus <strong>die</strong>ser Zeit. Wie oft ging ich unter <strong>de</strong>n immer<br />
grünen Bäumen am Gesta<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Meles, an <strong>de</strong>r Geburtsstätte meines Homer, und sammelt’ Opferblumen<br />
und warf sie in <strong>de</strong>n heiligen Strom! Zur nahen Grotte trat ich dann in meinen friedlichen Träumen, da hätte<br />
<strong>de</strong>r Alte, sagen sie, seine Ilia<strong>de</strong> gesungen. Ich fand ihn. Je<strong>de</strong>r Laut in mir verstummte vor seiner Gegenwart.<br />
Ich schlug sein göttlich Gedicht mir auf und es war, als hätt’ ich es nie gekannt, so ganz an<strong>de</strong>rs wurd’<br />
es jetzt lebendig in mir. (Schmidt, 1994: 27 f.)<br />
Der „Strom“, d.h. <strong>de</strong>r Fluss, ver<strong>die</strong>nt das Attribut „heilig“, weil er zur Geburtsstätte Homers gehört.<br />
Demenstrechend opfert Hyperion Blumen. Das „Gedicht“ ist offensichtlich <strong>die</strong> Ilias. „Göttlich“<br />
ist sie, weil sie in heiliger Sprache geschrieben ist, in <strong>de</strong>r Sprache, <strong>die</strong> es ermöglicht, dass<br />
<strong>de</strong>r Mensch in Kontakt zur göttlichen Natur kommen kann. Es han<strong>de</strong>lt sich um das berühmteste<br />
Werk <strong>de</strong>r von Höl<strong>de</strong>rlin i<strong>de</strong>alisierten Sprache und Kultur <strong>de</strong>s antiken Griechenlands. Heilig ist<br />
<strong>die</strong> Natur dort, und ebenso heilig sind <strong>die</strong> von Menschenhand geschriebenen Verse. Deswegen<br />
ist <strong>die</strong>se Sprache „lebendig“ im Herzen Hyperions, so dass er <strong>die</strong> Gegenwart Homers spürt.<br />
160