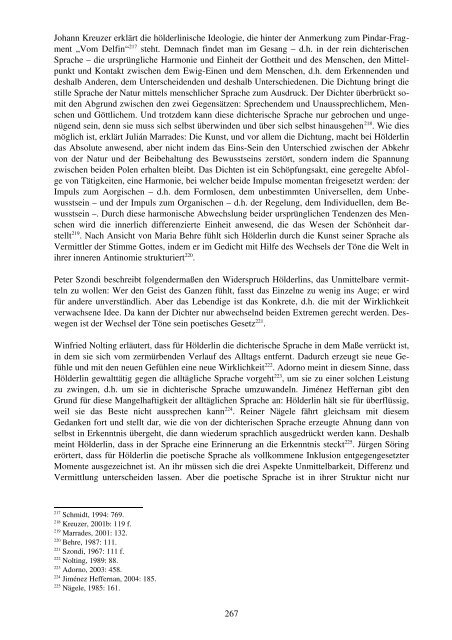die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Johann Kreuzer erklärt <strong>die</strong> höl<strong>de</strong>rlinische I<strong>de</strong>ologie, <strong>die</strong> hinter <strong>de</strong>r Anmerkung zum PindarFragment<br />
„Vom Delfin“ 217 steht. Demnach fin<strong>de</strong>t man im Gesang – d.h. in <strong>de</strong>r rein dichterischen<br />
Sprache – <strong>die</strong> ursprüngliche Harmonie und Einheit <strong>de</strong>r Gottheit und <strong>de</strong>s Menschen, <strong>de</strong>n Mittelpunkt<br />
und Kontakt zwischen <strong>de</strong>m EwigEinen und <strong>de</strong>m Menschen, d.h. <strong>de</strong>m Erkennen<strong>de</strong>n und<br />
<strong>de</strong>shalb An<strong>de</strong>ren, <strong>de</strong>m Unterschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>shalb Unterschie<strong>de</strong>nen. Die Dichtung bringt <strong>die</strong><br />
stille Sprache <strong>de</strong>r Natur mittels menschlicher Sprache zum Ausdruck. Der Dichter überbrückt somit<br />
<strong>de</strong>n Abgrund zwischen <strong>de</strong>n zwei Gegensätzen: Sprechen<strong>de</strong>m und Unaussprechlichem, Menschen<br />
und Göttlichem. Und trotz<strong>de</strong>m kann <strong>die</strong>se dichterische Sprache nur gebrochen und ungenügend<br />
sein, <strong>de</strong>nn sie muss sich selbst überwin<strong>de</strong>n und über sich selbst hinausgehen 218 . Wie <strong>die</strong>s<br />
möglich ist, erklärt Julián Marra<strong>de</strong>s: Die Kunst, und vor allem <strong>die</strong> Dichtung, macht bei Höl<strong>de</strong>rlin<br />
das Absolute anwesend, aber nicht in<strong>de</strong>m das EinsSein <strong>de</strong>n Unterschied zwischen <strong>de</strong>r Abkehr<br />
von <strong>de</strong>r Natur und <strong>de</strong>r Beibehaltung <strong>de</strong>s Bewusstseins zerstört, son<strong>de</strong>rn in<strong>de</strong>m <strong>die</strong> Spannung<br />
zwischen bei<strong>de</strong>n Polen erhalten bleibt. Das Dichten ist ein Schöpfungsakt, eine geregelte Abfolge<br />
von Tätigkeiten, eine Harmonie, bei welcher bei<strong>de</strong> Impulse momentan freigesetzt wer<strong>de</strong>n: <strong>de</strong>r<br />
Impuls zum Aorgischen – d.h. <strong>de</strong>m Formlosen, <strong>de</strong>m unbestimmten Universellen, <strong>de</strong>m Unbewusstsein<br />
– und <strong>de</strong>r Impuls zum Organischen – d.h. <strong>de</strong>r Regelung, <strong>de</strong>m Individuellen, <strong>de</strong>m Bewusstsein<br />
–. Durch <strong>die</strong>se harmonische Abwechslung bei<strong>de</strong>r ursprünglichen Ten<strong>de</strong>nzen <strong>de</strong>s Menschen<br />
wird <strong>die</strong> innerlich differenzierte Einheit anwesend, <strong>die</strong> das Wesen <strong>de</strong>r Schönheit darstellt<br />
219 . Nach Ansicht von Maria Behre fühlt sich Höl<strong>de</strong>rlin durch <strong>die</strong> Kunst seiner Sprache als<br />
Vermittler <strong>de</strong>r Stimme Gottes, in<strong>de</strong>m er im Gedicht mit Hilfe <strong>de</strong>s Wechsels <strong>de</strong>r Töne <strong>die</strong> Welt in<br />
ihrer inneren Antinomie strukturiert 220 .<br />
Peter Szondi beschreibt folgen<strong>de</strong>rmaßen <strong>de</strong>n Wi<strong>de</strong>rspruch Höl<strong>de</strong>rlins, das Unmittelbare vermitteln<br />
zu wollen: Wer <strong>de</strong>n Geist <strong>de</strong>s Ganzen fühlt, fasst das Einzelne zu wenig ins Auge; er wird<br />
für an<strong>de</strong>re unverständlich. Aber das Lebendige ist das Konkrete, d.h. <strong>die</strong> mit <strong>de</strong>r Wirklichkeit<br />
verwachsene I<strong>de</strong>e. Da kann <strong>de</strong>r Dichter nur abwechselnd bei<strong>de</strong>n Extremen gerecht wer<strong>de</strong>n. Deswegen<br />
ist <strong>de</strong>r Wechsel <strong>de</strong>r Töne sein poetisches Gesetz 221 .<br />
Winfried Nolting erläutert, dass für Höl<strong>de</strong>rlin <strong>die</strong> dichterische Sprache in <strong>de</strong>m Maße verrückt ist,<br />
in <strong>de</strong>m sie sich vom zermürben<strong>de</strong>n Verlauf <strong>de</strong>s Alltags entfernt. Dadurch erzeugt sie neue Gefühle<br />
und mit <strong>de</strong>n neuen Gefühlen eine neue Wirklichkeit 222 . Adorno meint in <strong>die</strong>sem Sinne, dass<br />
Höl<strong>de</strong>rlin gewalttätig gegen <strong>die</strong> alltägliche Sprache vorgeht 223 , um sie zu einer solchen Leistung<br />
zu zwingen, d.h. um sie in dichterische Sprache umzuwan<strong>de</strong>ln. Jiménez Heffernan gibt <strong>de</strong>n<br />
Grund für <strong>die</strong>se Mangelhaftigkeit <strong>de</strong>r alltäglichen Sprache an: Höl<strong>de</strong>rlin hält sie für überflüssig,<br />
weil sie das Beste nicht aussprechen kann 224 . Reiner Nägele fährt gleichsam mit <strong>die</strong>sem<br />
Gedanken fort und stellt dar, wie <strong>die</strong> von <strong>de</strong>r dichterischen Sprache erzeugte Ahnung dann von<br />
selbst in Erkenntnis übergeht, <strong>die</strong> dann wie<strong>de</strong>rum sprachlich ausgedrückt wer<strong>de</strong>n kann. Deshalb<br />
meint Höl<strong>de</strong>rlin, dass in <strong>de</strong>r Sprache eine Erinnerung an <strong>die</strong> Erkenntnis steckt 225 . Jürgen Söring<br />
erörtert, dass für Höl<strong>de</strong>rlin <strong>die</strong> poetische Sprache als vollkommene Inklusion entgegengesetzter<br />
Momente ausgezeichnet ist. An ihr müssen sich <strong>die</strong> drei Aspekte Unmittelbarkeit, Differenz und<br />
Vermittlung unterschei<strong>de</strong>n lassen. Aber <strong>die</strong> poetische Sprache ist in ihrer Struktur nicht nur<br />
217<br />
Schmidt, 1994: 769.<br />
218<br />
Kreuzer, 2001b: 119 f.<br />
219<br />
Marra<strong>de</strong>s, 2001: 132.<br />
220<br />
Behre, 1987: 111.<br />
221<br />
Szondi, 1967: 111 f.<br />
222<br />
Nolting, 1989: 88.<br />
223<br />
Adorno, 2003: 458.<br />
224<br />
Jiménez Heffernan, 2004: 185.<br />
225<br />
Nägele, 1985: 161.<br />
267