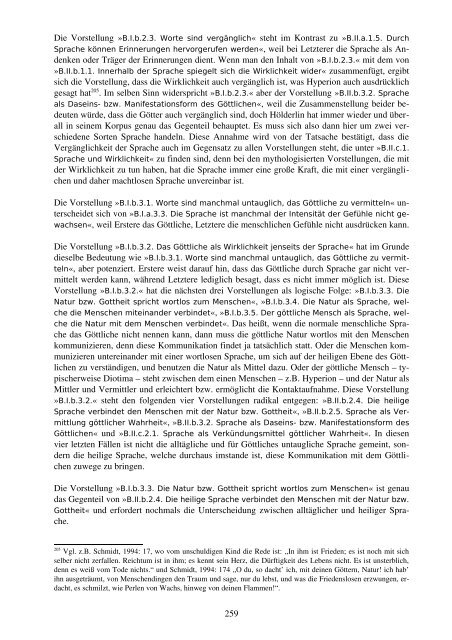die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Vorstellung »B.I.b.2.3. Worte sind vergänglich« steht im Kontrast zu »B.II.a.1.5. Durch<br />
Sprache können Erinnerungen hervorgerufen wer<strong>de</strong>n«, weil bei Letzterer <strong>die</strong> Sprache als An<strong>de</strong>nken<br />
o<strong>de</strong>r Träger <strong>de</strong>r Erinnerungen <strong>die</strong>nt. Wenn man <strong>de</strong>n Inhalt von »B.I.b.2.3.« mit <strong>de</strong>m von<br />
»B.II.b.1.1. Innerhalb <strong>de</strong>r Sprache spiegelt sich <strong>die</strong> Wirklichkeit wi<strong>de</strong>r« zusammenfügt, ergibt<br />
sich <strong>die</strong> Vorstellung, dass <strong>die</strong> Wirklichkeit auch vergänglich ist, was Hyperion auch ausdrücklich<br />
gesagt hat 205 . Im selben Sinn wi<strong>de</strong>rspricht »B.I.b.2.3.« aber <strong>de</strong>r Vorstellung »B.II.b.3.2. Sprache<br />
als Daseins- bzw. Manifestationsform <strong>de</strong>s Göttlichen«, weil <strong>die</strong> Zusammenstellung bei<strong>de</strong>r be<strong>de</strong>uten<br />
wür<strong>de</strong>, dass <strong>die</strong> Götter auch vergänglich sind, doch Höl<strong>de</strong>rlin hat immer wie<strong>de</strong>r und überall<br />
in seinem Korpus genau das Gegenteil behauptet. Es muss sich also dann hier um zwei verschie<strong>de</strong>ne<br />
Sorten Sprache han<strong>de</strong>ln. Diese Annahme wird von <strong>de</strong>r Tatsache bestätigt, dass <strong>die</strong><br />
Vergänglichkeit <strong>de</strong>r Sprache auch im Gegensatz zu allen Vorstellungen steht, <strong>die</strong> unter »B.II.c.1.<br />
Sprache und Wirklichkeit« zu fin<strong>de</strong>n sind, <strong>de</strong>nn bei <strong>de</strong>n mythologisierten Vorstellungen, <strong>die</strong> mit<br />
<strong>de</strong>r Wirklichkeit zu tun haben, hat <strong>die</strong> Sprache immer eine große Kraft, <strong>die</strong> mit einer vergänglichen<br />
und daher machtlosen Sprache unvereinbar ist.<br />
Die Vorstellung »B.I.b.3.1. Worte sind manchmal untauglich, das Göttliche zu vermitteln« unterschei<strong>de</strong>t<br />
sich von »B.I.a.3.3. Die Sprache ist manchmal <strong>de</strong>r Intensität <strong>de</strong>r Gefühle nicht gewachsen«,<br />
weil Erstere das Göttliche, Letztere <strong>die</strong> menschlichen Gefühle nicht ausdrücken kann.<br />
Die Vorstellung »B.I.b.3.2. Das Göttliche als Wirklichkeit jenseits <strong>de</strong>r Sprache« hat im Grun<strong>de</strong><br />
<strong>die</strong>selbe Be<strong>de</strong>utung wie »B.I.b.3.1. Worte sind manchmal untauglich, das Göttliche zu vermitteln«,<br />
aber potenziert. Erstere weist darauf hin, dass das Göttliche durch Sprache gar nicht vermittelt<br />
wer<strong>de</strong>n kann, während Letztere lediglich besagt, dass es nicht immer möglich ist. Diese<br />
Vorstellung »B.I.b.3.2.« hat <strong>die</strong> nächsten drei Vorstellungen als logische Folge: »B.I.b.3.3. Die<br />
Natur bzw. Gottheit spricht wortlos zum Menschen«, »B.I.b.3.4. Die Natur als Sprache, welche<br />
<strong>die</strong> Menschen miteinan<strong>de</strong>r verbin<strong>de</strong>t«, »B.I.b.3.5. Der göttliche Mensch als Sprache, welche<br />
<strong>die</strong> Natur mit <strong>de</strong>m Menschen verbin<strong>de</strong>t«. Das heißt, wenn <strong>die</strong> normale menschliche Sprache<br />
das Göttliche nicht nennen kann, dann muss <strong>die</strong> göttliche Natur wortlos mit <strong>de</strong>n Menschen<br />
kommunizieren, <strong>de</strong>nn <strong>die</strong>se Kommunikation fin<strong>de</strong>t ja tatsächlich statt. O<strong>de</strong>r <strong>die</strong> Menschen kommunizieren<br />
untereinan<strong>de</strong>r mit einer wortlosen Sprache, um sich auf <strong>de</strong>r heiligen Ebene <strong>de</strong>s Göttlichen<br />
zu verständigen, und benutzen <strong>die</strong> Natur als Mittel dazu. O<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r göttliche Mensch – typischerweise<br />
Diotima – steht zwischen <strong>de</strong>m einen Menschen – z.B. Hyperion – und <strong>de</strong>r Natur als<br />
Mittler und Vermittler und erleichtert bzw. ermöglicht <strong>die</strong> Kontaktaufnahme. Diese Vorstellung<br />
»B.I.b.3.2.« steht <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n vier Vorstellungen radikal entgegen: »B.II.b.2.4. Die heilige<br />
Sprache verbin<strong>de</strong>t <strong>de</strong>n Menschen mit <strong>de</strong>r Natur bzw. Gottheit«, »B.II.b.2.5. Sprache als Vermittlung<br />
göttlicher Wahrheit«, »B.II.b.3.2. Sprache als Daseins- bzw. Manifestationsform <strong>de</strong>s<br />
Göttlichen« und »B.II.c.2.1. Sprache als Verkündungsmittel göttlicher Wahrheit«. In <strong>die</strong>sen<br />
vier letzten Fällen ist nicht <strong>die</strong> alltägliche und für Göttliches untaugliche Sprache gemeint, son<strong>de</strong>rn<br />
<strong>die</strong> heilige Sprache, welche durchaus imstan<strong>de</strong> ist, <strong>die</strong>se Kommunikation mit <strong>de</strong>m Göttlichen<br />
zuwege zu bringen.<br />
Die Vorstellung »B.I.b.3.3. Die Natur bzw. Gottheit spricht wortlos zum Menschen« ist genau<br />
das Gegenteil von »B.II.b.2.4. Die heilige Sprache verbin<strong>de</strong>t <strong>de</strong>n Menschen mit <strong>de</strong>r Natur bzw.<br />
Gottheit« und erfor<strong>de</strong>rt nochmals <strong>die</strong> Unterscheidung zwischen alltäglicher und heiliger Sprache.<br />
205<br />
Vgl. z.B. Schmidt, 1994: 17, wo vom unschuldigen Kind <strong>die</strong> Re<strong>de</strong> ist: „In ihm ist Frie<strong>de</strong>n; es ist noch mit sich<br />
selber nicht zerfallen. Reichtum ist in ihm; es kennt sein Herz, <strong>die</strong> Dürftigkeit <strong>de</strong>s Lebens nicht. Es ist unsterblich,<br />
<strong>de</strong>nn es weiß vom To<strong>de</strong> nichts.“ und Schmidt, 1994: 174 „O du, so dacht’ ich, mit <strong>de</strong>inen Göttern, Natur! ich hab’<br />
ihn ausgeträumt, von Menschendingen <strong>de</strong>n Traum und sage, nur du lebst, und was <strong>die</strong> Frie<strong>de</strong>nslosen erzwungen, erdacht,<br />
es schmilzt, wie Perlen von Wachs, hinweg von <strong>de</strong>inen Flammen!“.<br />
259