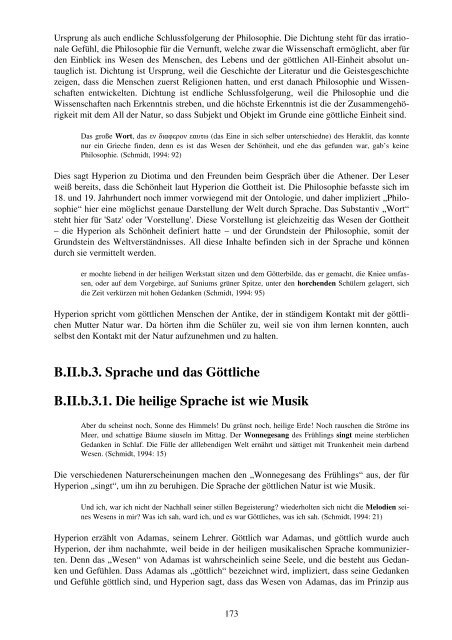die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ursprung als auch endliche Schlussfolgerung <strong>de</strong>r Philosophie. Die Dichtung steht für das irrationale<br />
Gefühl, <strong>die</strong> Philosophie für <strong>die</strong> Vernunft, welche zwar <strong>die</strong> Wissenschaft ermöglicht, aber für<br />
<strong>de</strong>n Einblick ins Wesen <strong>de</strong>s Menschen, <strong>de</strong>s Lebens und <strong>de</strong>r göttlichen AllEinheit absolut untauglich<br />
ist. Dichtung ist Ursprung, weil <strong>die</strong> Geschichte <strong>de</strong>r Literatur und <strong>die</strong> Geistesgeschichte<br />
zeigen, dass <strong>die</strong> Menschen zuerst Religionen hatten, und erst danach Philosophie und Wissenschaften<br />
entwickelten. Dichtung ist endliche Schlussfolgerung, weil <strong>die</strong> Philosophie und <strong>die</strong><br />
Wissenschaften nach Erkenntnis streben, und <strong>die</strong> höchste Erkenntnis ist <strong>die</strong> <strong>de</strong>r Zusammengehörigkeit<br />
mit <strong>de</strong>m All <strong>de</strong>r Natur, so dass Subjekt und Objekt im Grun<strong>de</strong> eine göttliche Einheit sind.<br />
Das große Wort, das εν διαφερον εαυτω (das Eine in sich selber unterschiedne) <strong>de</strong>s Heraklit, das konnte<br />
nur ein Grieche fin<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn es ist das Wesen <strong>de</strong>r Schönheit, und ehe das gefun<strong>de</strong>n war, gab’s keine<br />
Philosophie. (Schmidt, 1994: 92)<br />
Dies sagt Hyperion zu Diotima und <strong>de</strong>n Freun<strong>de</strong>n beim Gespräch über <strong>die</strong> Athener. Der Leser<br />
weiß bereits, dass <strong>die</strong> Schönheit laut Hyperion <strong>die</strong> Gottheit ist. Die Philosophie befasste sich im<br />
18. und 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt noch immer vorwiegend mit <strong>de</strong>r Ontologie, und daher impliziert „Philosophie“<br />
hier eine möglichst genaue Darstellung <strong>de</strong>r Welt durch Sprache. Das Substantiv „Wort“<br />
steht hier für 'Satz' o<strong>de</strong>r 'Vorstellung'. Diese Vorstellung ist gleichzeitig das Wesen <strong>de</strong>r Gottheit<br />
– <strong>die</strong> Hyperion als Schönheit <strong>de</strong>finiert hatte – und <strong>de</strong>r Grundstein <strong>de</strong>r Philosophie, somit <strong>de</strong>r<br />
Grundstein <strong>de</strong>s Weltverständnisses. All <strong>die</strong>se Inhalte befin<strong>de</strong>n sich in <strong>de</strong>r Sprache und können<br />
durch sie vermittelt wer<strong>de</strong>n.<br />
er mochte liebend in <strong>de</strong>r heiligen Werkstatt sitzen und <strong>de</strong>m Götterbil<strong>de</strong>, das er gemacht, <strong>die</strong> Kniee umfassen,<br />
o<strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>m Vorgebirge, auf Suniums grüner Spitze, unter <strong>de</strong>n horchen<strong>de</strong>n Schülern gelagert, sich<br />
<strong>die</strong> Zeit verkürzen mit hohen Gedanken (Schmidt, 1994: 95)<br />
Hyperion spricht vom göttlichen Menschen <strong>de</strong>r Antike, <strong>de</strong>r in ständigem Kontakt mit <strong>de</strong>r göttlichen<br />
Mutter Natur war. Da hörten ihm <strong>die</strong> Schüler zu, weil sie von ihm lernen konnten, auch<br />
selbst <strong>de</strong>n Kontakt mit <strong>de</strong>r Natur aufzunehmen und zu halten.<br />
B.II.b.3. Sprache und das Göttliche<br />
B.II.b.3.1. Die heilige Sprache ist wie Musik<br />
Aber du scheinst noch, Sonne <strong>de</strong>s Himmels! Du grünst noch, heilige Er<strong>de</strong>! Noch rauschen <strong>die</strong> Ströme ins<br />
Meer, und schattige Bäume säuseln im Mittag. Der Wonnegesang <strong>de</strong>s Frühlings singt meine sterblichen<br />
Gedanken in Schlaf. Die Fülle <strong>de</strong>r alllebendigen Welt ernährt und sättiget mit Trunkenheit mein darbend<br />
Wesen. (Schmidt, 1994: 15)<br />
Die verschie<strong>de</strong>nen Naturerscheinungen machen <strong>de</strong>n „Wonnegesang <strong>de</strong>s Frühlings“ aus, <strong>de</strong>r für<br />
Hyperion „singt“, um ihn zu beruhigen. Die Sprache <strong>de</strong>r göttlichen Natur ist wie Musik.<br />
Und ich, war ich nicht <strong>de</strong>r Nachhall seiner stillen Begeisterung? wie<strong>de</strong>rholten sich nicht <strong>die</strong> Melo<strong>die</strong>n seines<br />
Wesens in mir? Was ich sah, ward ich, und es war Göttliches, was ich sah. (Schmidt, 1994: 21)<br />
Hyperion erzählt von Adamas, seinem Lehrer. Göttlich war Adamas, und göttlich wur<strong>de</strong> auch<br />
Hyperion, <strong>de</strong>r ihm nachahmte, weil bei<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r heiligen musikalischen Sprache kommunizierten.<br />
Denn das „Wesen“ von Adamas ist wahrscheinlich seine Seele, und <strong>die</strong> besteht aus Gedanken<br />
und Gefühlen. Dass Adamas als „göttlich“ bezeichnet wird, impliziert, dass seine Gedanken<br />
und Gefühle göttlich sind, und Hyperion sagt, dass das Wesen von Adamas, das im Prinzip aus<br />
173