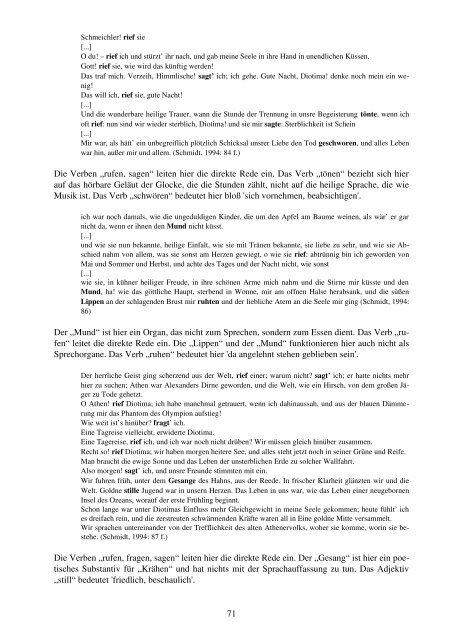die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schmeichler! rief sie<br />
[...]<br />
O du! – rief ich und stürzt’ ihr nach, und gab meine Seele in ihre Hand in unendlichen Küssen.<br />
Gott! rief sie, wie wird das künftig wer<strong>de</strong>n!<br />
Das traf mich. Verzeih, Himmlische! sagt’ ich; ich gehe. Gute Nacht, Diotima! <strong>de</strong>nke noch mein ein wenig!<br />
Das will ich, rief sie, gute Nacht!<br />
[...]<br />
Und <strong>die</strong> wun<strong>de</strong>rbare heilige Trauer, wann <strong>die</strong> Stun<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Trennung in unsre Begeisterung tönte, wenn ich<br />
oft rief: nun sind wir wie<strong>de</strong>r sterblich, Diotima! und sie mir sagte: Sterblichkeit ist Schein<br />
[...]<br />
Mir war, als hätt’ ein unbegreiflich plötzlich Schicksal unsrer Liebe <strong>de</strong>n Tod geschworen, und alles Leben<br />
war hin, außer mir und allem. (Schmidt, 1994: 84 f.)<br />
Die Verben „rufen, sagen“ leiten hier <strong>die</strong> direkte Re<strong>de</strong> ein. Das Verb „tönen“ bezieht sich hier<br />
auf das hörbare Geläut <strong>de</strong>r Glocke, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Stun<strong>de</strong>n zählt, nicht auf <strong>die</strong> heilige Sprache, <strong>die</strong> wie<br />
Musik ist. Das Verb „schwören“ be<strong>de</strong>utet hier bloß 'sich vornehmen, beabsichtigen'.<br />
ich war noch damals, wie <strong>die</strong> ungeduldigen Kin<strong>de</strong>r, <strong>die</strong> um <strong>de</strong>n Apfel am Baume weinen, als wär’ er gar<br />
nicht da, wenn er ihnen <strong>de</strong>n Mund nicht küsst.<br />
[...]<br />
und wie sie nun bekannte, heilige Einfalt, wie sie mit Tränen bekannte, sie liebe zu sehr, und wie sie Abschied<br />
nahm von allem, was sie sonst am Herzen gewiegt, o wie sie rief: abtrünnig bin ich gewor<strong>de</strong>n von<br />
Mai und Sommer und Herbst, und achte <strong>de</strong>s Tages und <strong>de</strong>r Nacht nicht, wie sonst<br />
[...]<br />
wie sie, in kühner heiliger Freu<strong>de</strong>, in ihre schönen Arme mich nahm und <strong>die</strong> Stirne mir küsste und <strong>de</strong>n<br />
Mund, ha! wie das göttliche Haupt, sterbend in Wonne, mir am offnen Halse herabsank, und <strong>die</strong> süßen<br />
Lippen an <strong>de</strong>r schlagen<strong>de</strong>n Brust mir ruhten und <strong>de</strong>r liebliche Atem an <strong>die</strong> Seele mir ging (Schmidt, 1994:<br />
86)<br />
Der „Mund“ ist hier ein Organ, das nicht zum Sprechen, son<strong>de</strong>rn zum Essen <strong>die</strong>nt. Das Verb „rufen“<br />
leitet <strong>die</strong> direkte Re<strong>de</strong> ein. Die „Lippen“ und <strong>de</strong>r „Mund“ funktionieren hier auch nicht als<br />
Sprechorgane. Das Verb „ruhen“ be<strong>de</strong>utet hier 'da angelehnt stehen geblieben sein'.<br />
Der herrliche Geist ging scherzend aus <strong>de</strong>r Welt, rief einer; warum nicht? sagt’ ich; er hatte nichts mehr<br />
hier zu suchen; Athen war Alexan<strong>de</strong>rs Dirne gewor<strong>de</strong>n, und <strong>die</strong> Welt, wie ein Hirsch, von <strong>de</strong>m großen Jäger<br />
zu To<strong>de</strong> gehetzt.<br />
O Athen! rief Diotima; ich habe manchmal getrauert, wenn ich dahinaussah, und aus <strong>de</strong>r blauen Dämmerung<br />
mir das Phantom <strong>de</strong>s Olympion aufstieg!<br />
Wie weit ist’s hinüber? fragt’ ich.<br />
Eine Tagreise vielleicht, erwi<strong>de</strong>rte Diotima.<br />
Eine Tagereise, rief ich, und ich war noch nicht drüben? Wir müssen gleich hinüber zusammen.<br />
Recht so! rief Diotima; wir haben morgen heitere See, und alles steht jetzt noch in seiner Grüne und Reife.<br />
Man braucht <strong>die</strong> ewige Sonne und das Leben <strong>de</strong>r unsterblichen Er<strong>de</strong> zu solcher Wallfahrt.<br />
Also morgen! sagt’ ich, und unsre Freun<strong>de</strong> stimmten mit ein.<br />
Wir fuhren früh, unter <strong>de</strong>m Gesange <strong>de</strong>s Hahns, aus <strong>de</strong>r Ree<strong>de</strong>. In frischer Klarheit glänzten wir und <strong>die</strong><br />
Welt. Goldne stille Jugend war in unsern Herzen. Das Leben in uns war, wie das Leben einer neugebornen<br />
Insel <strong>de</strong>s Ozeans, worauf <strong>de</strong>r erste Frühling beginnt.<br />
Schon lange war unter Diotimas Einfluss mehr Gleichgewicht in meine Seele gekommen; heute fühlt’ ich<br />
es dreifach rein, und <strong>die</strong> zerstreuten schwärmen<strong>de</strong>n Kräfte waren all in Eine goldne Mitte versammelt.<br />
Wir sprachen untereinan<strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Trefflichkeit <strong>de</strong>s alten Athenervolks, woher sie komme, worin sie bestehe.<br />
(Schmidt, 1994: 87 f.)<br />
Die Verben „rufen, fragen, sagen“ leiten hier <strong>die</strong> direkte Re<strong>de</strong> ein. Der „Gesang“ ist hier ein poetisches<br />
Substantiv für „Krähen“ und hat nichts mit <strong>de</strong>r Sprachauffassung zu tun. Das Adjektiv<br />
„still“ be<strong>de</strong>utet 'friedlich, beschaulich'.<br />
71