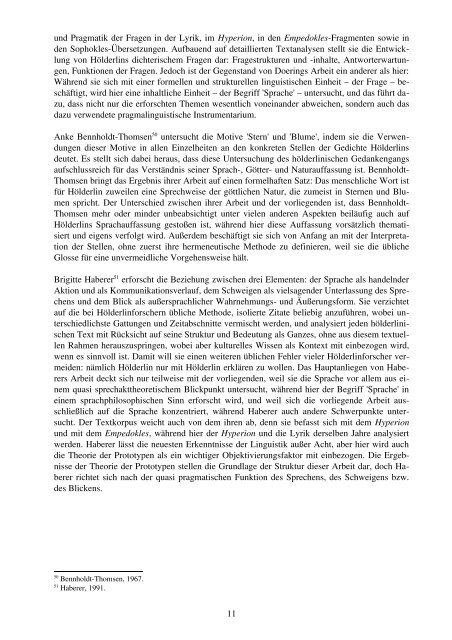die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
und Pragmatik <strong>de</strong>r Fragen in <strong>de</strong>r Lyrik, im Hyperion, in <strong>de</strong>n EmpedoklesFragmenten sowie in<br />
<strong>de</strong>n SophoklesÜbersetzungen. Aufbauend auf <strong>de</strong>taillierten Textanalysen stellt sie <strong>die</strong> Entwicklung<br />
von Höl<strong>de</strong>rlins dichterischem Fragen dar: Fragestrukturen und inhalte, Antworterwartungen,<br />
Funktionen <strong>de</strong>r Fragen. Jedoch ist <strong>de</strong>r Gegenstand von Doerings Arbeit ein an<strong>de</strong>rer als hier:<br />
Während sie sich mit einer formellen und strukturellen linguistischen Einheit – <strong>de</strong>r Frage – beschäftigt,<br />
wird hier eine inhaltliche Einheit – <strong>de</strong>r Begriff 'Sprache' – untersucht, und das führt dazu,<br />
dass nicht nur <strong>die</strong> erforschten Themen wesentlich voneinan<strong>de</strong>r abweichen, son<strong>de</strong>rn auch das<br />
dazu verwen<strong>de</strong>te pragmalinguistische Instrumentarium.<br />
Anke BennholdtThomsen 50 untersucht <strong>die</strong> Motive 'Stern' und 'Blume', in<strong>de</strong>m sie <strong>die</strong> Verwendungen<br />
<strong>die</strong>ser Motive in allen Einzelheiten an <strong>de</strong>n konkreten Stellen <strong>de</strong>r Gedichte Höl<strong>de</strong>rlins<br />
<strong>de</strong>utet. Es stellt sich dabei heraus, dass <strong>die</strong>se Untersuchung <strong>de</strong>s höl<strong>de</strong>rlinischen Gedankengangs<br />
aufschlussreich für das Verständnis seiner Sprach, Götter und Naturauffassung ist. Bennholdt<br />
Thomsen bringt das Ergebnis ihrer Arbeit auf einen formelhaften Satz: Das menschliche Wort ist<br />
für Höl<strong>de</strong>rlin zuweilen eine Sprechweise <strong>de</strong>r göttlichen Natur, <strong>die</strong> zumeist in Sternen und Blumen<br />
spricht. Der Unterschied zwischen ihrer Arbeit und <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n ist, dass Bennholdt<br />
Thomsen mehr o<strong>de</strong>r min<strong>de</strong>r unbeabsichtigt unter vielen an<strong>de</strong>ren Aspekten beiläufig auch auf<br />
Höl<strong>de</strong>rlins Sprachauffassung gestoßen ist, während hier <strong>die</strong>se Auffassung vorsätzlich thematisiert<br />
und eigens verfolgt wird. Außer<strong>de</strong>m beschäftigt sie sich von Anfang an mit <strong>de</strong>r Interpretation<br />
<strong>de</strong>r Stellen, ohne zuerst ihre hermeneutische Metho<strong>de</strong> zu <strong>de</strong>finieren, weil sie <strong>die</strong> übliche<br />
Glosse für eine unvermeidliche Vorgehensweise hält.<br />
Brigitte Haberer 51 erforscht <strong>die</strong> Beziehung zwischen drei Elementen: <strong>de</strong>r Sprache als han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>r<br />
Aktion und als Kommunikationsverlauf, <strong>de</strong>m Schweigen als vielsagen<strong>de</strong>r Unterlassung <strong>de</strong>s Sprechens<br />
und <strong>de</strong>m Blick als außersprachlicher Wahrnehmungs und Äußerungsform. Sie verzichtet<br />
auf <strong>die</strong> bei Höl<strong>de</strong>rlinforschern übliche Metho<strong>de</strong>, isolierte Zitate beliebig anzuführen, wobei unterschiedlichste<br />
Gattungen und Zeitabschnitte vermischt wer<strong>de</strong>n, und analysiert je<strong>de</strong>n höl<strong>de</strong>rlinischen<br />
Text mit Rücksicht auf seine Struktur und Be<strong>de</strong>utung als Ganzes, ohne aus <strong>die</strong>sem textuellen<br />
Rahmen herauszuspringen, wobei aber kulturelles Wissen als Kontext mit einbezogen wird,<br />
wenn es sinnvoll ist. Damit will sie einen weiteren üblichen Fehler vieler Höl<strong>de</strong>rlinforscher vermei<strong>de</strong>n:<br />
nämlich Höl<strong>de</strong>rlin nur mit Höl<strong>de</strong>rlin erklären zu wollen. Das Hauptanliegen von Haberers<br />
Arbeit <strong>de</strong>ckt sich nur teilweise mit <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n, weil sie <strong>die</strong> Sprache vor allem aus einem<br />
quasi sprechakttheoretischem Blickpunkt untersucht, während hier <strong>de</strong>r Begriff 'Sprache' in<br />
einem sprachphilosophischen Sinn erforscht wird, und weil sich <strong>die</strong> vorliegen<strong>de</strong> Arbeit ausschließlich<br />
auf <strong>die</strong> Sprache konzentriert, während Haberer auch an<strong>de</strong>re Schwerpunkte untersucht.<br />
Der Textkorpus weicht auch von <strong>de</strong>m ihren ab, <strong>de</strong>nn sie befasst sich mit <strong>de</strong>m Hyperion<br />
und mit <strong>de</strong>m Empedokles, während hier <strong>de</strong>r Hyperion und <strong>die</strong> Lyrik <strong>de</strong>rselben Jahre analysiert<br />
wer<strong>de</strong>n. Haberer lässt <strong>die</strong> neuesten Erkenntnisse <strong>de</strong>r Linguistik außer Acht, aber hier wird auch<br />
<strong>die</strong> Theorie <strong>de</strong>r Prototypen als ein wichtiger Objektivierungsfaktor mit einbezogen. Die Ergebnisse<br />
<strong>de</strong>r Theorie <strong>de</strong>r Prototypen stellen <strong>die</strong> Grundlage <strong>de</strong>r Struktur <strong>die</strong>ser Arbeit dar, doch Haberer<br />
richtet sich nach <strong>de</strong>r quasi pragmatischen Funktion <strong>de</strong>s Sprechens, <strong>de</strong>s Schweigens bzw.<br />
<strong>de</strong>s Blickens.<br />
50<br />
BennholdtThomsen, 1967.<br />
51<br />
Haberer, 1991.<br />
11