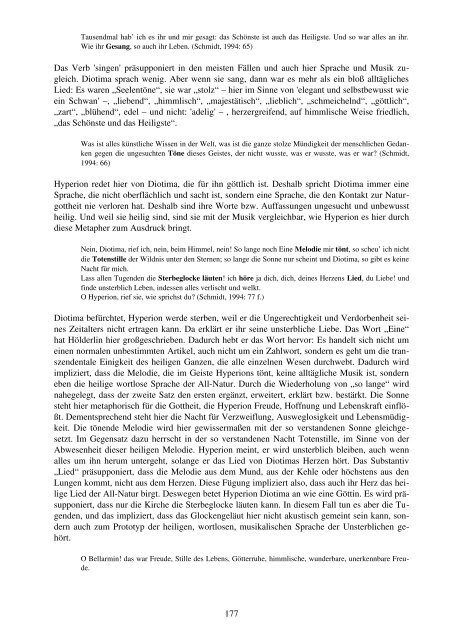die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Tausendmal hab’ ich es ihr und mir gesagt: das Schönste ist auch das Heiligste. Und so war alles an ihr.<br />
Wie ihr Gesang, so auch ihr Leben. (Schmidt, 1994: 65)<br />
Das Verb 'singen' präsupponiert in <strong>de</strong>n meisten Fällen und auch hier Sprache und Musik zugleich.<br />
Diotima sprach wenig. Aber wenn sie sang, dann war es mehr als ein bloß alltägliches<br />
Lied: Es waren „Seelentöne“, sie war „stolz“ – hier im Sinne von 'elegant und selbstbewusst wie<br />
ein Schwan' –, „liebend“, „himmlisch“, „majestätisch“, „lieblich“, „schmeichelnd“, „göttlich“,<br />
„zart“, „blühend“, e<strong>de</strong>l – und nicht: 'a<strong>de</strong>lig' – , herzergreifend, auf himmlische Weise friedlich,<br />
„das Schönste und das Heiligste“.<br />
Was ist alles künstliche Wissen in <strong>de</strong>r Welt, was ist <strong>die</strong> ganze stolze Mündigkeit <strong>de</strong>r menschlichen Gedanken<br />
gegen <strong>die</strong> ungesuchten Töne <strong>die</strong>ses Geistes, <strong>de</strong>r nicht wusste, was er wusste, was er war? (Schmidt,<br />
1994: 66)<br />
Hyperion re<strong>de</strong>t hier von Diotima, <strong>die</strong> für ihn göttlich ist. Deshalb spricht Diotima immer eine<br />
Sprache, <strong>die</strong> nicht oberflächlich und sacht ist, son<strong>de</strong>rn eine Sprache, <strong>die</strong> <strong>de</strong>n Kontakt zur Naturgottheit<br />
nie verloren hat. Deshalb sind ihre Worte bzw. Auffassungen ungesucht und unbewusst<br />
heilig. Und weil sie heilig sind, sind sie mit <strong>de</strong>r Musik vergleichbar, wie Hyperion es hier durch<br />
<strong>die</strong>se Metapher zum Ausdruck bringt.<br />
Nein, Diotima, rief ich, nein, beim Himmel, nein! So lange noch Eine Melo<strong>die</strong> mir tönt, so scheu’ ich nicht<br />
<strong>die</strong> Totenstille <strong>de</strong>r Wildnis unter <strong>de</strong>n Sternen; so lange <strong>die</strong> Sonne nur scheint und Diotima, so gibt es keine<br />
Nacht für mich.<br />
Lass allen Tugen<strong>de</strong>n <strong>die</strong> Sterbeglocke läuten! ich höre ja dich, dich, <strong>de</strong>ines Herzens Lied, du Liebe! und<br />
fin<strong>de</strong> unsterblich Leben, in<strong>de</strong>ssen alles verlischt und welkt.<br />
O Hyperion, rief sie, wie sprichst du? (Schmidt, 1994: 77 f.)<br />
Diotima befürchtet, Hyperion wer<strong>de</strong> sterben, weil er <strong>die</strong> Ungerechtigkeit und Verdorbenheit seines<br />
Zeitalters nicht ertragen kann. Da erklärt er ihr seine unsterbliche Liebe. Das Wort „Eine“<br />
hat Höl<strong>de</strong>rlin hier großgeschrieben. Dadurch hebt er das Wort hervor: Es han<strong>de</strong>lt sich nicht um<br />
einen normalen unbestimmten Artikel, auch nicht um ein Zahlwort, son<strong>de</strong>rn es geht um <strong>die</strong> transzen<strong>de</strong>ntale<br />
Einigkeit <strong>de</strong>s heiligen Ganzen, <strong>die</strong> alle einzelnen Wesen durchwebt. Dadurch wird<br />
impliziert, dass <strong>die</strong> Melo<strong>die</strong>, <strong>die</strong> im Geiste Hyperions tönt, keine alltägliche Musik ist, son<strong>de</strong>rn<br />
eben <strong>die</strong> heilige wortlose Sprache <strong>de</strong>r AllNatur. Durch <strong>die</strong> Wie<strong>de</strong>rholung von „so lange“ wird<br />
nahegelegt, dass <strong>de</strong>r zweite Satz <strong>de</strong>n ersten ergänzt, erweitert, erklärt bzw. bestärkt. Die Sonne<br />
steht hier metaphorisch für <strong>die</strong> Gottheit, <strong>die</strong> Hyperion Freu<strong>de</strong>, Hoffnung und Lebenskraft einflößt.<br />
Dementsprechend steht hier <strong>die</strong> Nacht für Verzweiflung, Ausweglosigkeit und Lebensmüdigkeit.<br />
Die tönen<strong>de</strong> Melo<strong>die</strong> wird hier gewissermaßen mit <strong>de</strong>r so verstan<strong>de</strong>nen Sonne gleichgesetzt.<br />
Im Gegensatz dazu herrscht in <strong>de</strong>r so verstan<strong>de</strong>nen Nacht Totenstille, im Sinne von <strong>de</strong>r<br />
Abwesenheit <strong>die</strong>ser heiligen Melo<strong>die</strong>. Hyperion meint, er wird unsterblich bleiben, auch wenn<br />
alles um ihn herum untergeht, solange er das Lied von Diotimas Herzen hört. Das Substantiv<br />
„Lied“ präsupponiert, dass <strong>die</strong> Melo<strong>die</strong> aus <strong>de</strong>m Mund, aus <strong>de</strong>r Kehle o<strong>de</strong>r höchstens aus <strong>de</strong>n<br />
Lungen kommt, nicht aus <strong>de</strong>m Herzen. Diese Fügung impliziert also, dass auch ihr Herz das heilige<br />
Lied <strong>de</strong>r AllNatur birgt. Deswegen betet Hyperion Diotima an wie eine Göttin. Es wird präsupponiert,<br />
dass nur <strong>die</strong> Kirche <strong>die</strong> Sterbeglocke läuten kann. In <strong>die</strong>sem Fall tun es aber <strong>die</strong> Tugen<strong>de</strong>n,<br />
und das impliziert, dass das Glockengeläut hier nicht akustisch gemeint sein kann, son<strong>de</strong>rn<br />
auch zum Prototyp <strong>de</strong>r heiligen, wortlosen, musikalischen Sprache <strong>de</strong>r Unsterblichen gehört.<br />
O Bellarmin! das war Freu<strong>de</strong>, Stille <strong>de</strong>s Lebens, Götterruhe, himmlische, wun<strong>de</strong>rbare, unerkennbare Freu<strong>de</strong>.<br />
177