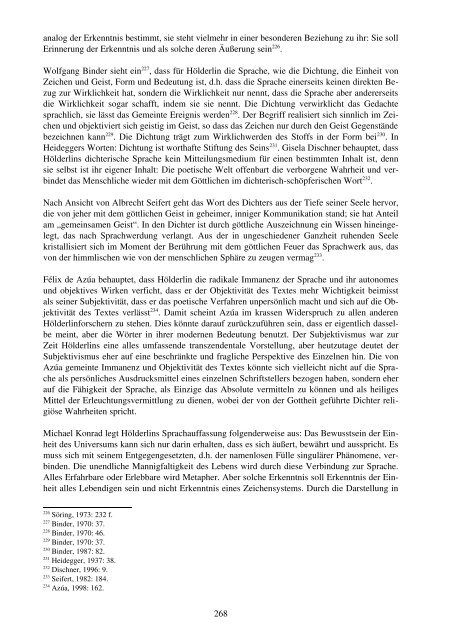die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
analog <strong>de</strong>r Erkenntnis bestimmt, sie steht vielmehr in einer beson<strong>de</strong>ren Beziehung zu ihr: Sie soll<br />
Erinnerung <strong>de</strong>r Erkenntnis und als solche <strong>de</strong>ren Äußerung sein 226 .<br />
Wolfgang Bin<strong>de</strong>r sieht ein 227 , dass für Höl<strong>de</strong>rlin <strong>die</strong> Sprache, wie <strong>die</strong> Dichtung, <strong>die</strong> Einheit von<br />
Zeichen und Geist, Form und Be<strong>de</strong>utung ist, d.h. dass <strong>die</strong> Sprache einerseits keinen direkten Bezug<br />
zur Wirklichkeit hat, son<strong>de</strong>rn <strong>die</strong> Wirklichkeit nur nennt, dass <strong>die</strong> Sprache aber an<strong>de</strong>rerseits<br />
<strong>die</strong> Wirklichkeit sogar schafft, in<strong>de</strong>m sie sie nennt. Die Dichtung verwirklicht das Gedachte<br />
sprachlich, sie lässt das Gemeinte Ereignis wer<strong>de</strong>n 228 . Der Begriff realisiert sich sinnlich im Zeichen<br />
und objektiviert sich geistig im Geist, so dass das Zeichen nur durch <strong>de</strong>n Geist Gegenstän<strong>de</strong><br />
bezeichnen kann 229 . Die Dichtung trägt zum Wirklichwer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Stoffs in <strong>de</strong>r Form bei 230 . In<br />
Hei<strong>de</strong>ggers Worten: Dichtung ist worthafte Stiftung <strong>de</strong>s Seins 231 . Gisela Dischner behauptet, dass<br />
Höl<strong>de</strong>rlins dichterische Sprache kein Mitteilungsmedium für einen bestimmten Inhalt ist, <strong>de</strong>nn<br />
sie selbst ist ihr eigener Inhalt: Die poetische Welt offenbart <strong>die</strong> verborgene Wahrheit und verbin<strong>de</strong>t<br />
das Menschliche wie<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Göttlichen im dichterischschöpferischen Wort 232 .<br />
Nach Ansicht von Albrecht Seifert geht das Wort <strong>de</strong>s Dichters aus <strong>de</strong>r Tiefe seiner Seele hervor,<br />
<strong>die</strong> von jeher mit <strong>de</strong>m göttlichen Geist in geheimer, inniger Kommunikation stand; sie hat Anteil<br />
am „gemeinsamen Geist“. In <strong>de</strong>n Dichter ist durch göttliche Auszeichnung ein Wissen hineingelegt,<br />
das nach Sprachwerdung verlangt. Aus <strong>de</strong>r in ungeschie<strong>de</strong>ner Ganzheit ruhen<strong>de</strong>n Seele<br />
kristallisiert sich im Moment <strong>de</strong>r Berührung mit <strong>de</strong>m göttlichen Feuer das Sprachwerk aus, das<br />
von <strong>de</strong>r himmlischen wie von <strong>de</strong>r menschlichen Sphäre zu zeugen vermag 233 .<br />
Félix <strong>de</strong> Azúa behauptet, dass Höl<strong>de</strong>rlin <strong>die</strong> radikale Immanenz <strong>de</strong>r Sprache und ihr autonomes<br />
und objektives Wirken verficht, dass er <strong>de</strong>r Objektivität <strong>de</strong>s Textes mehr Wichtigkeit beimisst<br />
als seiner Subjektivität, dass er das poetische Verfahren unpersönlich macht und sich auf <strong>die</strong> Objektivität<br />
<strong>de</strong>s Textes verlässt 234 . Damit scheint Azúa im krassen Wi<strong>de</strong>rspruch zu allen an<strong>de</strong>ren<br />
Höl<strong>de</strong>rlinforschern zu stehen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass er eigentlich dasselbe<br />
meint, aber <strong>die</strong> Wörter in ihrer mo<strong>de</strong>rnen Be<strong>de</strong>utung benutzt. Der Subjektivismus war zur<br />
Zeit Höl<strong>de</strong>rlins eine alles umfassen<strong>de</strong> transzen<strong>de</strong>ntale Vorstellung, aber heutzutage <strong>de</strong>utet <strong>de</strong>r<br />
Subjektivismus eher auf eine beschränkte und fragliche Perspektive <strong>de</strong>s Einzelnen hin. Die von<br />
Azúa gemeinte Immanenz und Objektivität <strong>de</strong>s Textes könnte sich vielleicht nicht auf <strong>die</strong> Sprache<br />
als persönliches Ausdrucksmittel eines einzelnen Schriftstellers bezogen haben, son<strong>de</strong>rn eher<br />
auf <strong>die</strong> Fähigkeit <strong>de</strong>r Sprache, als Einzige das Absolute vermitteln zu können und als heiliges<br />
Mittel <strong>de</strong>r Erleuchtungsvermittlung zu <strong>die</strong>nen, wobei <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Gottheit geführte Dichter religiöse<br />
Wahrheiten spricht.<br />
Michael Konrad legt Höl<strong>de</strong>rlins Sprachauffassung folgen<strong>de</strong>rweise aus: Das Bewusstsein <strong>de</strong>r Einheit<br />
<strong>de</strong>s Universums kann sich nur darin erhalten, dass es sich äußert, bewährt und ausspricht. Es<br />
muss sich mit seinem Entgegengesetzten, d.h. <strong>de</strong>r namenlosen Fülle singulärer Phänomene, verbin<strong>de</strong>n.<br />
Die unendliche Mannigfaltigkeit <strong>de</strong>s Lebens wird durch <strong>die</strong>se Verbindung zur Sprache.<br />
Alles Erfahrbare o<strong>de</strong>r Erlebbare wird Metapher. Aber solche Erkenntnis soll Erkenntnis <strong>de</strong>r Einheit<br />
alles Lebendigen sein und nicht Erkenntnis eines Zeichensystems. Durch <strong>die</strong> Darstellung in<br />
226<br />
Söring, 1973: 232 f.<br />
227<br />
Bin<strong>de</strong>r, 1970: 37.<br />
228<br />
Bin<strong>de</strong>r, 1970: 46.<br />
229<br />
Bin<strong>de</strong>r, 1970: 37.<br />
230<br />
Bin<strong>de</strong>r, 1987: 82.<br />
231<br />
Hei<strong>de</strong>gger, 1937: 38.<br />
232<br />
Dischner, 1996: 9.<br />
233<br />
Seifert, 1982: 184.<br />
234<br />
Azúa, 1998: 162.<br />
268