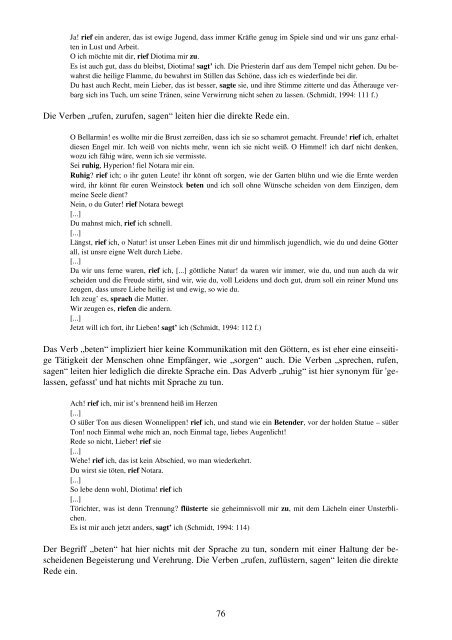die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ja! rief ein an<strong>de</strong>rer, das ist ewige Jugend, dass immer Kräfte genug im Spiele sind und wir uns ganz erhalten<br />
in Lust und Arbeit.<br />
O ich möchte mit dir, rief Diotima mir zu.<br />
Es ist auch gut, dass du bleibst, Diotima! sagt’ ich. Die Priesterin darf aus <strong>de</strong>m Tempel nicht gehen. Du bewahrst<br />
<strong>die</strong> heilige Flamme, du bewahrst im Stillen das Schöne, dass ich es wie<strong>de</strong>rfin<strong>de</strong> bei dir.<br />
Du hast auch Recht, mein Lieber, das ist besser, sagte sie, und ihre Stimme zitterte und das Ätherauge verbarg<br />
sich ins Tuch, um seine Tränen, seine Verwirrung nicht sehen zu lassen. (Schmidt, 1994: 111 f.)<br />
Die Verben „rufen, zurufen, sagen“ leiten hier <strong>die</strong> direkte Re<strong>de</strong> ein.<br />
O Bellarmin! es wollte mir <strong>die</strong> Brust zerreißen, dass ich sie so schamrot gemacht. Freun<strong>de</strong>! rief ich, erhaltet<br />
<strong>die</strong>sen Engel mir. Ich weiß von nichts mehr, wenn ich sie nicht weiß. O Himmel! ich darf nicht <strong>de</strong>nken,<br />
wozu ich fähig wäre, wenn ich sie vermisste.<br />
Sei ruhig, Hyperion! fiel Notara mir ein.<br />
Ruhig? rief ich; o ihr guten Leute! ihr könnt oft sorgen, wie <strong>de</strong>r Garten blühn und wie <strong>die</strong> Ernte wer<strong>de</strong>n<br />
wird, ihr könnt für euren Weinstock beten und ich soll ohne Wünsche schei<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>m Einzigen, <strong>de</strong>m<br />
meine Seele <strong>die</strong>nt?<br />
Nein, o du Guter! rief Notara bewegt<br />
[...]<br />
Du mahnst mich, rief ich schnell.<br />
[...]<br />
Längst, rief ich, o Natur! ist unser Leben Eines mit dir und himmlisch jugendlich, wie du und <strong>de</strong>ine Götter<br />
all, ist unsre eigne Welt durch Liebe.<br />
[...]<br />
Da wir uns ferne waren, rief ich, [...] göttliche Natur! da waren wir immer, wie du, und nun auch da wir<br />
schei<strong>de</strong>n und <strong>die</strong> Freu<strong>de</strong> stirbt, sind wir, wie du, voll Lei<strong>de</strong>ns und doch gut, drum soll ein reiner Mund uns<br />
zeugen, dass unsre Liebe heilig ist und ewig, so wie du.<br />
Ich zeug’ es, sprach <strong>die</strong> Mutter.<br />
Wir zeugen es, riefen <strong>die</strong> an<strong>de</strong>rn.<br />
[...]<br />
Jetzt will ich fort, ihr Lieben! sagt’ ich (Schmidt, 1994: 112 f.)<br />
Das Verb „beten“ impliziert hier keine Kommunikation mit <strong>de</strong>n Göttern, es ist eher eine einseitige<br />
Tätigkeit <strong>de</strong>r Menschen ohne Empfänger, wie „sorgen“ auch. Die Verben „sprechen, rufen,<br />
sagen“ leiten hier lediglich <strong>die</strong> direkte Sprache ein. Das Adverb „ruhig“ ist hier synonym für 'gelassen,<br />
gefasst' und hat nichts mit Sprache zu tun.<br />
Ach! rief ich, mir ist’s brennend heiß im Herzen<br />
[...]<br />
O süßer Ton aus <strong>die</strong>sen Wonnelippen! rief ich, und stand wie ein Beten<strong>de</strong>r, vor <strong>de</strong>r hol<strong>de</strong>n Statue – süßer<br />
Ton! noch Einmal wehe mich an, noch Einmal tage, liebes Augenlicht!<br />
Re<strong>de</strong> so nicht, Lieber! rief sie<br />
[...]<br />
Wehe! rief ich, das ist kein Abschied, wo man wie<strong>de</strong>rkehrt.<br />
Du wirst sie töten, rief Notara.<br />
[...]<br />
So lebe <strong>de</strong>nn wohl, Diotima! rief ich<br />
[...]<br />
Törichter, was ist <strong>de</strong>nn Trennung? flüsterte sie geheimnisvoll mir zu, mit <strong>de</strong>m Lächeln einer Unsterblichen.<br />
Es ist mir auch jetzt an<strong>de</strong>rs, sagt’ ich (Schmidt, 1994: 114)<br />
Der Begriff „beten“ hat hier nichts mit <strong>de</strong>r Sprache zu tun, son<strong>de</strong>rn mit einer Haltung <strong>de</strong>r beschei<strong>de</strong>nen<br />
Begeisterung und Verehrung. Die Verben „rufen, zuflüstern, sagen“ leiten <strong>die</strong> direkte<br />
Re<strong>de</strong> ein.<br />
76