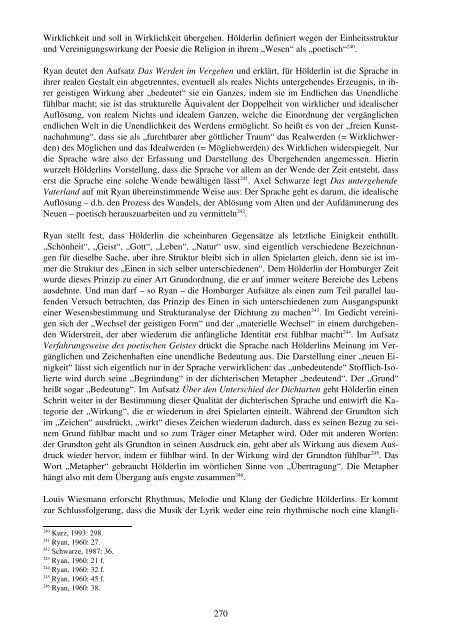die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wirklichkeit und soll in Wirklichkeit übergehen. Höl<strong>de</strong>rlin <strong>de</strong>finiert wegen <strong>de</strong>r Einheitsstruktur<br />
und Vereinigungswirkung <strong>de</strong>r Poesie <strong>die</strong> Religion in ihrem „Wesen“ als „poetisch“ 240 .<br />
Ryan <strong>de</strong>utet <strong>de</strong>n Aufsatz Das Wer<strong>de</strong>n im Vergehen und erklärt, für Höl<strong>de</strong>rlin ist <strong>die</strong> Sprache in<br />
ihrer realen Gestalt ein abgetrenntes, eventuell als reales Nichts untergehen<strong>de</strong>s Erzeugnis, in ihrer<br />
geistigen Wirkung aber „be<strong>de</strong>utet“ sie ein Ganzes, in<strong>de</strong>m sie im Endlichen das Unendliche<br />
fühlbar macht; sie ist das strukturelle Äquivalent <strong>de</strong>r Doppelheit von wirklicher und i<strong>de</strong>alischer<br />
Auflösung, von realem Nichts und i<strong>de</strong>alem Ganzen, welche <strong>die</strong> Einordnung <strong>de</strong>r vergänglichen<br />
endlichen Welt in <strong>die</strong> Unendlichkeit <strong>de</strong>s Wer<strong>de</strong>ns ermöglicht. So heißt es von <strong>de</strong>r „freien Kunstnachahmung“,<br />
dass sie als „furchtbarer aber göttlicher Traum“ das Realwer<strong>de</strong>n (= Wirklichwer<strong>de</strong>n)<br />
<strong>de</strong>s Möglichen und das I<strong>de</strong>alwer<strong>de</strong>n (= Möglichwer<strong>de</strong>n) <strong>de</strong>s Wirklichen wi<strong>de</strong>rspiegelt. Nur<br />
<strong>die</strong> Sprache wäre also <strong>de</strong>r Erfassung und Darstellung <strong>de</strong>s Übergehen<strong>de</strong>n angemessen. Hierin<br />
wurzelt Höl<strong>de</strong>rlins Vorstellung, dass <strong>die</strong> Sprache vor allem an <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Zeit entsteht, dass<br />
erst <strong>die</strong> Sprache eine solche Wen<strong>de</strong> bewältigen lässt 241 . Axel Schwarze legt Das untergehen<strong>de</strong><br />
Vaterland auf mit Ryan übereinstimmen<strong>de</strong> Weise aus: Der Sprache geht es darum, <strong>die</strong> i<strong>de</strong>alische<br />
Auflösung – d.h. <strong>de</strong>n Prozess <strong>de</strong>s Wan<strong>de</strong>ls, <strong>de</strong>r Ablösung vom Alten und <strong>de</strong>r Aufdämmerung <strong>de</strong>s<br />
Neuen – poetisch herauszuarbeiten und zu vermitteln 242 .<br />
Ryan stellt fest, dass Höl<strong>de</strong>rlin <strong>die</strong> scheinbaren Gegensätze als letztliche Einigkeit enthüllt.<br />
„Schönheit“, „Geist“, „Gott“, „Leben“, „Natur“ usw. sind eigentlich verschie<strong>de</strong>ne Bezeichnungen<br />
für <strong>die</strong>selbe Sache, aber ihre Struktur bleibt sich in allen Spielarten gleich, <strong>de</strong>nn sie ist immer<br />
<strong>die</strong> Struktur <strong>de</strong>s „Einen in sich selber unterschie<strong>de</strong>nen“. Dem Höl<strong>de</strong>rlin <strong>de</strong>r Homburger Zeit<br />
wur<strong>de</strong> <strong>die</strong>ses Prinzip zu einer Art Grundordnung, <strong>die</strong> er auf immer weitere Bereiche <strong>de</strong>s Lebens<br />
aus<strong>de</strong>hnte. Und man darf – so Ryan – <strong>die</strong> Homburger Aufsätze als einen zum Teil parallel laufen<strong>de</strong>n<br />
Versuch betrachten, das Prinzip <strong>de</strong>s Einen in sich unterschie<strong>de</strong>nen zum Ausgangspunkt<br />
einer Wesensbestimmung und Strukturanalyse <strong>de</strong>r Dichtung zu machen 243 . Im Gedicht vereinigen<br />
sich <strong>de</strong>r „Wechsel <strong>de</strong>r geistigen Form“ und <strong>de</strong>r „materielle Wechsel“ in einem durchgehen<strong>de</strong>n<br />
Wi<strong>de</strong>rstreit, <strong>de</strong>r aber wie<strong>de</strong>rum <strong>die</strong> anfängliche I<strong>de</strong>ntität erst fühlbar macht 244 . Im Aufsatz<br />
Verfahrungsweise <strong>de</strong>s poetischen Geistes drückt <strong>die</strong> Sprache nach Höl<strong>de</strong>rlins Meinung im Vergänglichen<br />
und Zeichenhaften eine unendliche Be<strong>de</strong>utung aus. Die Darstellung einer „neuen Einigkeit“<br />
lässt sich eigentlich nur in <strong>de</strong>r Sprache verwirklichen: das „unbe<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>“ StofflichIsolierte<br />
wird durch seine „Begründung“ in <strong>de</strong>r dichterischen Metapher „be<strong>de</strong>utend“. Der „Grund“<br />
heißt sogar „Be<strong>de</strong>utung“. Im Aufsatz Über <strong>de</strong>n Unterschied <strong>de</strong>r Dichtarten geht Höl<strong>de</strong>rlin einen<br />
Schritt weiter in <strong>de</strong>r Bestimmung <strong>die</strong>ser Qualität <strong>de</strong>r dichterischen Sprache und entwirft <strong>die</strong> Kategorie<br />
<strong>de</strong>r „Wirkung“, <strong>die</strong> er wie<strong>de</strong>rum in drei Spielarten einteilt. Während <strong>de</strong>r Grundton sich<br />
im „Zeichen“ ausdrückt, „wirkt“ <strong>die</strong>ses Zeichen wie<strong>de</strong>rum dadurch, dass es seinen Bezug zu seinem<br />
Grund fühlbar macht und so zum Träger einer Metapher wird. O<strong>de</strong>r mit an<strong>de</strong>ren Worten:<br />
<strong>de</strong>r Grundton geht als Grundton in seinen Ausdruck ein, geht aber als Wirkung aus <strong>die</strong>sem Ausdruck<br />
wie<strong>de</strong>r hervor, in<strong>de</strong>m er fühlbar wird. In <strong>de</strong>r Wirkung wird <strong>de</strong>r Grundton fühlbar 245 . Das<br />
Wort „Metapher“ gebraucht Höl<strong>de</strong>rlin im wörtlichen Sinne von „Übertragung“. Die Metapher<br />
hängt also mit <strong>de</strong>m Übergang aufs engste zusammen 246 .<br />
Louis Wiesmann erforscht Rhythmus, Melo<strong>die</strong> und Klang <strong>de</strong>r Gedichte Höl<strong>de</strong>rlins. Er kommt<br />
zur Schlussfolgerung, dass <strong>die</strong> Musik <strong>de</strong>r Lyrik we<strong>de</strong>r eine rein rhythmische noch eine klangli<br />
240<br />
Kurz, 1993: 298.<br />
241<br />
Ryan, 1960: 27.<br />
242<br />
Schwarze, 1987: 36.<br />
243<br />
Ryan, 1960: 21 f.<br />
244<br />
Ryan, 1960: 32 f.<br />
245<br />
Ryan, 1960: 45 f.<br />
246<br />
Ryan, 1960: 38.<br />
270