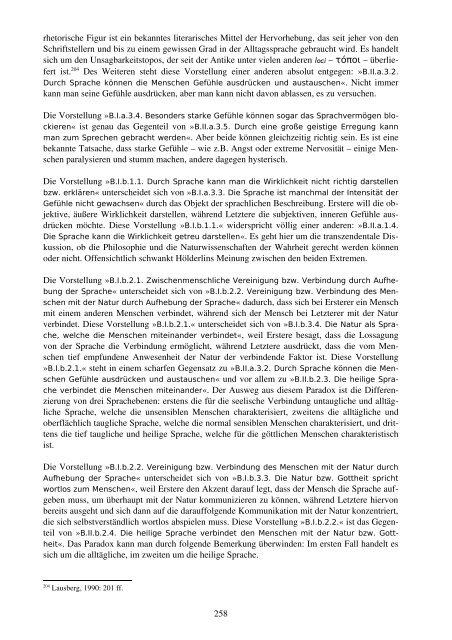die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
hetorische Figur ist ein bekanntes literarisches Mittel <strong>de</strong>r Hervorhebung, das seit jeher von <strong>de</strong>n<br />
Schriftstellern und bis zu einem gewissen Grad in <strong>de</strong>r Alltagssprache gebraucht wird. Es han<strong>de</strong>lt<br />
sich um <strong>de</strong>n Unsagbarkeitstopos, <strong>de</strong>r seit <strong>de</strong>r Antike unter vielen an<strong>de</strong>ren loci – τόποι – überliefert<br />
ist. 204 Des Weiteren steht <strong>die</strong>se Vorstellung einer an<strong>de</strong>ren absolut entgegen: »B.II.a.3.2.<br />
Durch Sprache können <strong>die</strong> Menschen Gefühle ausdrücken und austauschen«. Nicht immer<br />
kann man seine Gefühle ausdrücken, aber man kann nicht davon ablassen, es zu versuchen.<br />
Die Vorstellung »B.I.a.3.4. Beson<strong>de</strong>rs starke Gefühle können sogar das Sprachvermögen blockieren«<br />
ist genau das Gegenteil von »B.II.a.3.5. Durch eine große geistige Erregung kann<br />
man zum Sprechen gebracht wer<strong>de</strong>n«. Aber bei<strong>de</strong> können gleichzeitig richtig sein. Es ist eine<br />
bekannte Tatsache, dass starke Gefühle – wie z.B. Angst o<strong>de</strong>r extreme Nervosität – einige Menschen<br />
paralysieren und stumm machen, an<strong>de</strong>re dagegen hysterisch.<br />
Die Vorstellung »B.I.b.1.1. Durch Sprache kann man <strong>die</strong> Wirklichkeit nicht richtig darstellen<br />
bzw. erklären« unterschei<strong>de</strong>t sich von »B.I.a.3.3. Die Sprache ist manchmal <strong>de</strong>r Intensität <strong>de</strong>r<br />
Gefühle nicht gewachsen« durch das Objekt <strong>de</strong>r sprachlichen Beschreibung. Erstere will <strong>die</strong> objektive,<br />
äußere Wirklichkeit darstellen, während Letztere <strong>die</strong> subjektiven, inneren Gefühle ausdrücken<br />
möchte. Diese Vorstellung »B.I.b.1.1.« wi<strong>de</strong>rspricht völlig einer an<strong>de</strong>ren: »B.II.a.1.4.<br />
Die Sprache kann <strong>die</strong> Wirklichkeit getreu darstellen«. Es geht hier um <strong>die</strong> transzen<strong>de</strong>ntale Diskussion,<br />
ob <strong>die</strong> Philosophie und <strong>die</strong> Naturwissenschaften <strong>de</strong>r Wahrheit gerecht wer<strong>de</strong>n können<br />
o<strong>de</strong>r nicht. Offensichtlich schwankt Höl<strong>de</strong>rlins Meinung zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Extremen.<br />
Die Vorstellung »B.I.b.2.1. Zwischenmenschliche Vereinigung bzw. Verbindung durch Aufhebung<br />
<strong>de</strong>r Sprache« unterschei<strong>de</strong>t sich von »B.I.b.2.2. Vereinigung bzw. Verbindung <strong>de</strong>s Menschen<br />
mit <strong>de</strong>r Natur durch Aufhebung <strong>de</strong>r Sprache« dadurch, dass sich bei Ersterer ein Mensch<br />
mit einem an<strong>de</strong>ren Menschen verbin<strong>de</strong>t, während sich <strong>de</strong>r Mensch bei Letzterer mit <strong>de</strong>r Natur<br />
verbin<strong>de</strong>t. Diese Vorstellung »B.I.b.2.1.« unterschei<strong>de</strong>t sich von »B.I.b.3.4. Die Natur als Sprache,<br />
welche <strong>die</strong> Menschen miteinan<strong>de</strong>r verbin<strong>de</strong>t«, weil Erstere besagt, dass <strong>die</strong> Lossagung<br />
von <strong>de</strong>r Sprache <strong>die</strong> Verbindung ermöglicht, während Letztere ausdrückt, dass <strong>die</strong> vom Menschen<br />
tief empfun<strong>de</strong>ne Anwesenheit <strong>de</strong>r Natur <strong>de</strong>r verbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Faktor ist. Diese Vorstellung<br />
»B.I.b.2.1.« steht in einem scharfen Gegensatz zu »B.II.a.3.2. Durch Sprache können <strong>die</strong> Menschen<br />
Gefühle ausdrücken und austauschen« und vor allem zu »B.II.b.2.3. Die heilige Sprache<br />
verbin<strong>de</strong>t <strong>die</strong> Menschen miteinan<strong>de</strong>r«. Der Ausweg aus <strong>die</strong>sem Paradox ist <strong>die</strong> Differenzierung<br />
von drei Sprachebenen: erstens <strong>die</strong> für <strong>die</strong> seelische Verbindung untaugliche und alltägliche<br />
Sprache, welche <strong>die</strong> unsensiblen Menschen charakterisiert, zweitens <strong>die</strong> alltägliche und<br />
oberflächlich taugliche Sprache, welche <strong>die</strong> normal sensiblen Menschen charakterisiert, und drittens<br />
<strong>die</strong> tief taugliche und heilige Sprache, welche für <strong>die</strong> göttlichen Menschen charakteristisch<br />
ist.<br />
Die Vorstellung »B.I.b.2.2. Vereinigung bzw. Verbindung <strong>de</strong>s Menschen mit <strong>de</strong>r Natur durch<br />
Aufhebung <strong>de</strong>r Sprache« unterschei<strong>de</strong>t sich von »B.I.b.3.3. Die Natur bzw. Gottheit spricht<br />
wortlos zum Menschen«, weil Erstere <strong>de</strong>n Akzent darauf legt, dass <strong>de</strong>r Mensch <strong>die</strong> Sprache aufgeben<br />
muss, um überhaupt mit <strong>de</strong>r Natur kommunizieren zu können, während Letztere hiervon<br />
bereits ausgeht und sich dann auf <strong>die</strong> darauffolgen<strong>de</strong> Kommunikation mit <strong>de</strong>r Natur konzentriert,<br />
<strong>die</strong> sich selbstverständlich wortlos abspielen muss. Diese Vorstellung »B.I.b.2.2.« ist das Gegenteil<br />
von »B.II.b.2.4. Die heilige Sprache verbin<strong>de</strong>t <strong>de</strong>n Menschen mit <strong>de</strong>r Natur bzw. Gottheit«.<br />
Das Paradox kann man durch folgen<strong>de</strong> Bemerkung überwin<strong>de</strong>n: Im ersten Fall han<strong>de</strong>lt es<br />
sich um <strong>die</strong> alltägliche, im zweiten um <strong>die</strong> heilige Sprache.<br />
204<br />
Lausberg, 1990: 201 ff.<br />
258