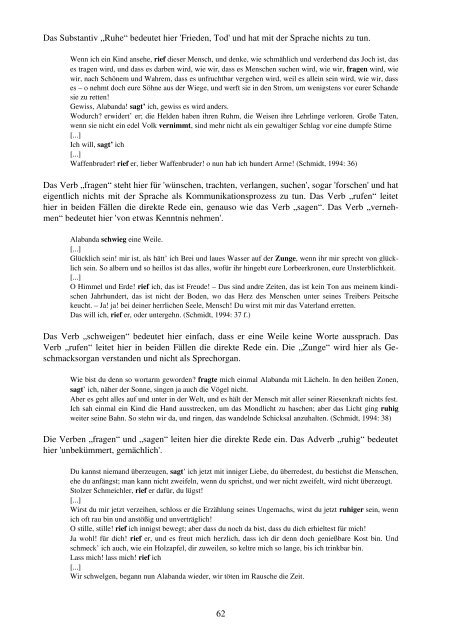die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
die immanente sprachauffassung - Roderic - Universitat de València
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Das Substantiv „Ruhe“ be<strong>de</strong>utet hier 'Frie<strong>de</strong>n, Tod' und hat mit <strong>de</strong>r Sprache nichts zu tun.<br />
Wenn ich ein Kind ansehe, rief <strong>die</strong>ser Mensch, und <strong>de</strong>nke, wie schmählich und ver<strong>de</strong>rbend das Joch ist, das<br />
es tragen wird, und dass es darben wird, wie wir, dass es Menschen suchen wird, wie wir, fragen wird, wie<br />
wir, nach Schönem und Wahrem, dass es unfruchtbar vergehen wird, weil es allein sein wird, wie wir, dass<br />
es – o nehmt doch eure Söhne aus <strong>de</strong>r Wiege, und werft sie in <strong>de</strong>n Strom, um wenigstens vor eurer Schan<strong>de</strong><br />
sie zu retten!<br />
Gewiss, Alabanda! sagt’ ich, gewiss es wird an<strong>de</strong>rs.<br />
Wodurch? erwi<strong>de</strong>rt’ er; <strong>die</strong> Hel<strong>de</strong>n haben ihren Ruhm, <strong>die</strong> Weisen ihre Lehrlinge verloren. Große Taten,<br />
wenn sie nicht ein e<strong>de</strong>l Volk vernimmt, sind mehr nicht als ein gewaltiger Schlag vor eine dumpfe Stirne<br />
[...]<br />
Ich will, sagt’ ich<br />
[...]<br />
Waffenbru<strong>de</strong>r! rief er, lieber Waffenbru<strong>de</strong>r! o nun hab ich hun<strong>de</strong>rt Arme! (Schmidt, 1994: 36)<br />
Das Verb „fragen“ steht hier für 'wünschen, trachten, verlangen, suchen', sogar 'forschen' und hat<br />
eigentlich nichts mit <strong>de</strong>r Sprache als Kommunikationsprozess zu tun. Das Verb „rufen“ leitet<br />
hier in bei<strong>de</strong>n Fällen <strong>die</strong> direkte Re<strong>de</strong> ein, genauso wie das Verb „sagen“. Das Verb „vernehmen“<br />
be<strong>de</strong>utet hier 'von etwas Kenntnis nehmen'.<br />
Alabanda schwieg eine Weile.<br />
[...]<br />
Glücklich sein! mir ist, als hätt’ ich Brei und laues Wasser auf <strong>de</strong>r Zunge, wenn ihr mir sprecht von glücklich<br />
sein. So albern und so heillos ist das alles, wofür ihr hingebt eure Lorbeerkronen, eure Unsterblichkeit.<br />
[...]<br />
O Himmel und Er<strong>de</strong>! rief ich, das ist Freu<strong>de</strong>! – Das sind andre Zeiten, das ist kein Ton aus meinem kindischen<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt, das ist nicht <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>n, wo das Herz <strong>de</strong>s Menschen unter seines Treibers Peitsche<br />
keucht. – Ja! ja! bei <strong>de</strong>iner herrlichen Seele, Mensch! Du wirst mit mir das Vaterland erretten.<br />
Das will ich, rief er, o<strong>de</strong>r untergehn. (Schmidt, 1994: 37 f.)<br />
Das Verb „schweigen“ be<strong>de</strong>utet hier einfach, dass er eine Weile keine Worte aussprach. Das<br />
Verb „rufen“ leitet hier in bei<strong>de</strong>n Fällen <strong>die</strong> direkte Re<strong>de</strong> ein. Die „Zunge“ wird hier als Geschmacksorgan<br />
verstan<strong>de</strong>n und nicht als Sprechorgan.<br />
Wie bist du <strong>de</strong>nn so wortarm gewor<strong>de</strong>n? fragte mich einmal Alabanda mit Lächeln. In <strong>de</strong>n heißen Zonen,<br />
sagt’ ich, näher <strong>de</strong>r Sonne, singen ja auch <strong>die</strong> Vögel nicht.<br />
Aber es geht alles auf und unter in <strong>de</strong>r Welt, und es hält <strong>de</strong>r Mensch mit aller seiner Riesenkraft nichts fest.<br />
Ich sah einmal ein Kind <strong>die</strong> Hand ausstrecken, um das Mondlicht zu haschen; aber das Licht ging ruhig<br />
weiter seine Bahn. So stehn wir da, und ringen, das wan<strong>de</strong>ln<strong>de</strong> Schicksal anzuhalten. (Schmidt, 1994: 38)<br />
Die Verben „fragen“ und „sagen“ leiten hier <strong>die</strong> direkte Re<strong>de</strong> ein. Das Adverb „ruhig“ be<strong>de</strong>utet<br />
hier 'unbekümmert, gemächlich'.<br />
Du kannst niemand überzeugen, sagt’ ich jetzt mit inniger Liebe, du überre<strong>de</strong>st, du bestichst <strong>die</strong> Menschen,<br />
ehe du anfängst; man kann nicht zweifeln, wenn du sprichst, und wer nicht zweifelt, wird nicht überzeugt.<br />
Stolzer Schmeichler, rief er dafür, du lügst!<br />
[...]<br />
Wirst du mir jetzt verzeihen, schloss er <strong>die</strong> Erzählung seines Ungemachs, wirst du jetzt ruhiger sein, wenn<br />
ich oft rau bin und anstößig und unverträglich!<br />
O stille, stille! rief ich innigst bewegt; aber dass du noch da bist, dass du dich erhieltest für mich!<br />
Ja wohl! für dich! rief er, und es freut mich herzlich, dass ich dir <strong>de</strong>nn doch genießbare Kost bin. Und<br />
schmeck’ ich auch, wie ein Holzapfel, dir zuweilen, so keltre mich so lange, bis ich trinkbar bin.<br />
Lass mich! lass mich! rief ich<br />
[...]<br />
Wir schwelgen, begann nun Alabanda wie<strong>de</strong>r, wir töten im Rausche <strong>die</strong> Zeit.<br />
62