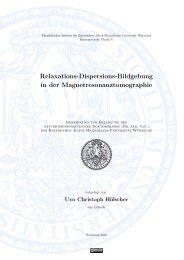- Seite 1 und 2:
Alkoholismus als biographisches Ere
- Seite 3 und 4:
6.8 Theorieansätze aus entwicklung
- Seite 5 und 6:
Interpretation Person B............
- Seite 7 und 8:
Interview N .......................
- Seite 9 und 10:
Ferner zielen auch die Mehrzahl der
- Seite 11 und 12:
Zusammenhänge nimmt, sondern Erleb
- Seite 13 und 14:
2.1 Geschichte Bereits in der Zeits
- Seite 15 und 16:
Alkoholkonsums wird hier ersichtlic
- Seite 17 und 18:
Trinker von moralischer Schuld frei
- Seite 19 und 20:
moralisierenden Position durchsetze
- Seite 21 und 22:
2.2 Weitere Typologien und Verlaufs
- Seite 23 und 24:
Eine weitere Phaseneinteilung der T
- Seite 25 und 26:
Diese Entwicklungen führen zu grun
- Seite 27 und 28:
2.3 Definitionsversuche der WHO In
- Seite 29 und 30:
entarten. Dem Begriff „Sucht” w
- Seite 31 und 32:
2.4 Eine ungewöhnliche Definition:
- Seite 33 und 34:
ezieht sich auf wesentliche Merkmal
- Seite 35 und 36:
In dieser Missbrauchsdefinition wer
- Seite 37 und 38:
7. fortgesetzter Alkoholmissbrauch
- Seite 39 und 40:
DSM müssen 3 Kriterien irgendwann
- Seite 41 und 42:
Ein vielfach verwendetes und standa
- Seite 43 und 44:
Ein weiterer wichtiger Fragebogente
- Seite 45 und 46:
3. Fazit Wir haben nun viele versch
- Seite 47 und 48:
sind, und doch weichen die jeweilig
- Seite 49 und 50:
Eine weitere indirekte Methode zur
- Seite 51 und 52:
Einen Überblick über die Verteilu
- Seite 53 und 54:
Mortalität Alkoholbezogene Todesf
- Seite 55 und 56:
5. Alkoholstoffwechsel Um die multi
- Seite 57 und 58:
Dabei sind vor allem zwei Enzymsyst
- Seite 59 und 60:
ADH ALDH Alkohol Leber H20 Fett Aze
- Seite 61 und 62:
• BAK bis 1,0 • Beginnender Ver
- Seite 63 und 64:
6. Ursachen Die Ursachen, welche zu
- Seite 65 und 66:
Nach dem Suchtdreieck und auch nach
- Seite 67 und 68:
nordeuropäisch-protestantischen Au
- Seite 69 und 70:
Auch wird durch Konsum in der Freiz
- Seite 71 und 72:
Hinsichtlich der äußeren Familien
- Seite 73 und 74:
Andere Merkmale für alkoholgefähr
- Seite 75 und 76:
• Auch durch den Wandel der Struk
- Seite 77 und 78:
empfindet“ (ebd., 160) Dadurch f
- Seite 79 und 80:
6.3 Genetische Ursachen Welche Roll
- Seite 81 und 82:
In einer Adoptionsstudie konnte gez
- Seite 83 und 84:
Typ I Typ II Eher von Umweltfaktore
- Seite 85 und 86:
• Starke Feldabhängigkeit, was v
- Seite 87 und 88:
Um die neurobiologischen Mechanisme
- Seite 89 und 90:
neurobiologischen Grundlagen der Su
- Seite 91 und 92:
Eine wesentliche Rolle in diesem Be
- Seite 93 und 94:
Endogene Opioide Es gibt eine so ge
- Seite 95 und 96:
6.5 Psychodynamische Theorieansätz
- Seite 97 und 98:
Rost bemerkt kritisch, dass nicht a
- Seite 99 und 100:
Macht, Einfluss auf Andere). Phäno
- Seite 101 und 102:
damit der Spannungs-Reduktions-Hypo
- Seite 103 und 104:
Marlatt hat auf dieser Grundlage ei
- Seite 105 und 106:
Der Übergang von einem Ausrutscher
- Seite 107 und 108:
Eine weitere bedeutende Therapieric
- Seite 109 und 110:
Annahme zugrunde, dass das Austrage
- Seite 111 und 112:
6.8 Theorieansätze aus entwicklung
- Seite 113 und 114:
6.9 Die Selbstkonzepttheorie Nach E
- Seite 115 und 116:
7. Fazit Wir haben nun soziale, soz
- Seite 117 und 118:
• Dabei krampfhaftes Meiden von T
- Seite 119 und 120:
8.2 Komorbidität von Alkoholismus
- Seite 121 und 122:
(vgl. Soyka 1994) Meist geht die Er
- Seite 123 und 124:
8.3 Soziale Folgeschäden Eng in Zu
- Seite 125 und 126:
auch oft zu Diebstählen oder im en
- Seite 127 und 128:
• Tremor (Hände, Zunge, Augenlid
- Seite 129 und 130:
gereizter Stimmung), aber auch Appe
- Seite 131 und 132:
kardiale Störungen, Myopathien und
- Seite 133 und 134:
8.4.3 Organstörungen 8.4.3.1 Leber
- Seite 135 und 136:
Alkoholzirrhose Die Alkoholzirrhose
- Seite 137 und 138:
Lebertransplantation Die Frage, ob
- Seite 139 und 140:
Die Prozentzahlen geben die angenä
- Seite 141 und 142:
eine Assoziation zwischen Alkohol u
- Seite 143 und 144:
den Tonus des unteren Ösophagusphi
- Seite 145 und 146:
Bei der erosiven Form kann es zu ei
- Seite 147 und 148:
8.4.3.4 Alkohol und Darm In Gegenwa
- Seite 149 und 150:
Akute und Chronische Mukosaschädig
- Seite 151 und 152:
Kolon und Rektum Chronischer Alkoho
- Seite 153 und 154:
8.4.3.6 Alkohol und Herz/Kreislauf
- Seite 155 und 156:
Auftreten der koronaren Herzkrankhe
- Seite 157 und 158:
Hämolyse Bei einer Hämolyse ist d
- Seite 159 und 160:
8.4.4.2 Alkohol und Stoffwechsel Li
- Seite 161 und 162:
8.4.4.3 Alkohol und Ernährung „A
- Seite 163 und 164:
Magenschleimhaut Folsäure Nukleins
- Seite 165 und 166:
8.4.4.4 Alkohol und endokrine Drüs
- Seite 167 und 168:
(Thyreotropin-stimulierendes-Hormon
- Seite 169 und 170:
limitiert sind. (vgl. Henning & Zie
- Seite 171 und 172:
Diskoides Ekzem Das diskoide Ekzem
- Seite 173 und 174:
• Brustkrebs (vgl. Teschke 1999,
- Seite 175 und 176:
8.4.4.8 Störungen des Muskelsystem
- Seite 177 und 178:
8.5.1 Neuronale und neuroanatomisch
- Seite 179 und 180:
8.5.3 Störungen neuronaler und bio
- Seite 181 und 182:
8.5.4 Hirnorganische Schädigungen
- Seite 183 und 184:
Menche N. 1999, 191) Über den Hypo
- Seite 185 und 186:
Symptome: Am Beginn der Krankheit s
- Seite 187 und 188:
Typischerweise sind die Patienten d
- Seite 189 und 190:
orbitale präfrontale Kortex wird m
- Seite 191 und 192:
herausfinden soll. Er verfehlt die
- Seite 193 und 194:
- Vermindertes Schlafbedürfnis Dep
- Seite 195 und 196:
Substanzbedingte Persönlichkeitsve
- Seite 197 und 198:
8.5.7 Alkoholische Kleinhirnatrophi
- Seite 199 und 200:
Neben den kognitven Beeinträchtigu
- Seite 201 und 202:
8.6.2 Alkoholischer Tremor Ein Trem
- Seite 203 und 204:
8.6.7 Nicotinsäuremangel-Enzephalo
- Seite 205 und 206:
9. Chronisch mehrfach beeinträchti
- Seite 207 und 208:
Der Definitionsvorschlag bezieht si
- Seite 209 und 210:
Zuordnung. Besonders bedeutsam für
- Seite 211 und 212:
Die jeweiligen Fragen werden mit Ja
- Seite 213 und 214:
• Polyneuropathien • Kardiomyop
- Seite 215 und 216:
10. Diskussion Diese vielen doch se
- Seite 217 und 218:
11. Alkoholismustherapie und Behand
- Seite 219 und 220:
In dieser Phase geht es vorwiegend
- Seite 221 und 222:
kann, den Mut Dinge zu ändern, die
- Seite 223 und 224:
11.6 Entwöhnungsbehandlung mit alk
- Seite 225 und 226:
Eine Verhaltenstendenz sollte nicht
- Seite 227 und 228:
11.8 Abwehrmechanismen Ein für die
- Seite 229 und 230:
„1. Alcoholics can be described i
- Seite 231 und 232:
Auch die Rationalisierung wird gena
- Seite 233 und 234:
12. Die Soziotherapie Wie bereits i
- Seite 235 und 236:
Grawe Faktor 4 ‚Ressourcenorienti
- Seite 237 und 238:
Körperhygiene oder Tätigkeiten wi
- Seite 239 und 240:
Förderung sozialer und kommunikati
- Seite 241 und 242:
die Betroffenen zu Wort kommen läs
- Seite 243 und 244:
Für Gesundheit wird folgende Defin
- Seite 245 und 246:
Auch die zahlreichen Definitionen,
- Seite 247 und 248:
14.2 Von den definitorischen Proble
- Seite 249 und 250:
Er fasst zusammen: „Ja, ich behau
- Seite 251 und 252: Dabei geht es um eine Innenschau, d
- Seite 253 und 254: Zusammenfassend wurde in diesem Abs
- Seite 255 und 256: Bei Blankenburg finden wir einen ä
- Seite 257 und 258: 14.4 Das Interesse der Erziehungswi
- Seite 259 und 260: Krankheit, speziell der Alkoholismu
- Seite 261 und 262: Im Zeitalter der Aufklärung, die e
- Seite 263 und 264: Somit ist also in Anknüpfung an di
- Seite 265 und 266: Das Innenleben, das anhand dieser S
- Seite 267 und 268: Dazu muss man wissen, dass die Fina
- Seite 269 und 270: In jedem Bereich kann dann untersch
- Seite 271 und 272: Sicherlich hat dieses System seine
- Seite 273 und 274: „Die Abkürzung ‚CMA‘ und auc
- Seite 275 und 276: Denn gegenüber den quantitativen A
- Seite 277 und 278: Einen weiteren Beitrag in diese Ric
- Seite 279 und 280: Bittner kritisiert die Versuche, ve
- Seite 281 und 282: 17. Erhebung, Transkription und Int
- Seite 283 und 284: 18. Annäherung an die Erhebungsmet
- Seite 285 und 286: Vorkenntnissen, Vorurteilen oder Th
- Seite 287 und 288: (Bortz & Döring 2002, 306) In den
- Seite 289 und 290: sind, gleichwohl aber folgenreiche
- Seite 291 und 292: wie nichtsprachlichen Symbolen repr
- Seite 293 und 294: zumindest durch Gegensatzpaare char
- Seite 295 und 296: 18.3 Die Methode: (Pädagogische) B
- Seite 297 und 298: In der Wissenschaft stößt dieser
- Seite 299 und 300: Der „subjektive Faktor“ (Bittne
- Seite 301: „Wer sich zum eigentlichen Beobac
- Seite 305 und 306: „Bildung ist Reflexionstatsache.
- Seite 307 und 308: Das Interesse richtet sich vor alle
- Seite 309 und 310: 1. Aushandlungsphase 2. Haupterzäh
- Seite 311 und 312: Autonomie zugewiesen, seine Erlebni
- Seite 313 und 314: mit einzubauen, um dadurch festzust
- Seite 315 und 316: Interviewarrangement wurde ja...dem
- Seite 317 und 318: 18.6 Die wissenschaftliche Methode
- Seite 319 und 320: werden ‚dauernd fixierte Lebenszu
- Seite 321 und 322: Damit wird wieder deutlich, worauf
- Seite 323 und 324: verstanden werden können. Wälzer
- Seite 325 und 326: Bezug auf unterschiedliche Therapeu
- Seite 327 und 328: Interpretation Person A Soziographi
- Seite 329 und 330: Schließlich lernt er seine Frau ke
- Seite 331 und 332: „...da habe ich die erste Zeit sc
- Seite 333 und 334: Wesentlich interessanter ist jedoch
- Seite 335 und 336: Was die Frage nach der Zukunft anbe
- Seite 337 und 338: Lebensstationen kommt er auf den Al
- Seite 339 und 340: „...na ja also ich ich hoffe dass
- Seite 341 und 342: ist das nicht normal!...da blicke i
- Seite 343 und 344: Fragen abschweifen und das zu erzä
- Seite 345 und 346: Interpretation Person C Soziodemogr
- Seite 347 und 348: na ja und das habe ich dann gemacht
- Seite 349 und 350: Herr C. ist sich der Gefahren eines
- Seite 351 und 352: Arbeit, wie es weiter oben beschrie
- Seite 353 und 354:
Rückzugstendenzen geführt. Er hat
- Seite 355 und 356:
An diesem Zitat wird auch noch einm
- Seite 357 und 358:
Frau D. ist dann zwei Jahre alleine
- Seite 359 und 360:
Dann erzählt sie vom Missbrauch au
- Seite 361 und 362:
*Thomas da?´ `Mama die sind drinne
- Seite 363 und 364:
Zum ersten Mal verwendet sie das Wo
- Seite 365 und 366:
mehr oder weniger sich selbst über
- Seite 367 und 368:
Geschehnisse nicht zu sehr ‚an si
- Seite 369 und 370:
geworden ist und dann war mein Lebe
- Seite 371 und 372:
Die Zukunft stellt sich Herr E. fol
- Seite 373 und 374:
funktionieren...wenn man beim *Albe
- Seite 375 und 376:
Deutungsmustern, bei der subjektive
- Seite 377 und 378:
ich jetzt da irgendwie ausgeflippt
- Seite 379 und 380:
„...ich habe den Kran nicht mehr
- Seite 381 und 382:
Monate dann haben sie gesagt `gehen
- Seite 383 und 384:
und meine eigene Wohnung wieder bek
- Seite 385 und 386:
„...er hat auch gesagt er möchte
- Seite 387 und 388:
wenn ich da konsumiert habe ich hab
- Seite 389 und 390:
und...von Montag bis Freitag und da
- Seite 391 und 392:
Gerichtsverhandlung da habe ich dan
- Seite 393 und 394:
„...ja also und dann kam es zu ei
- Seite 395 und 396:
„...er muss ja noch eine Zeit lan
- Seite 397 und 398:
also wirklich wie ein Jugendknast w
- Seite 399 und 400:
„...und dann habe ich mich in den
- Seite 401 und 402:
„...sagen wir einmal so im Prinzi
- Seite 403 und 404:
„Herr H. hat durch die Drogen und
- Seite 405 und 406:
Interpretation Person I Soziodemogr
- Seite 407 und 408:
angefangen hat weil ich auswärts u
- Seite 409 und 410:
auch einen großen Teil dazu beiget
- Seite 411 und 412:
Interpretation Person J Soziodemogr
- Seite 413 und 414:
Auch der Hinweis, dass er körperli
- Seite 415 und 416:
alles total versifft war, schlimmer
- Seite 417 und 418:
den anderen Tag Mon- das war sonnta
- Seite 419 und 420:
„...er hat vier Töchter...und da
- Seite 421 und 422:
es dadurch besser wird es sieht ger
- Seite 423 und 424:
„...aber bei mir ist es dann so g
- Seite 425 und 426:
Jedoch ist auch die zweite Ehe gesc
- Seite 427 und 428:
schon so schlimm war und dass ich a
- Seite 429 und 430:
da immer lieber auf Nummer Sicher:
- Seite 431 und 432:
Ein großer Einbruch ist dann, wie
- Seite 433 und 434:
„...zweieinhalb Jahren wieder Kon
- Seite 435 und 436:
Interpretation Person L Soziodemogr
- Seite 437 und 438:
„...dann bin ich heimgekommen dan
- Seite 439 und 440:
sagen zu 95 Prozent bin ich hergest
- Seite 441 und 442:
Zu den Beeinträchtigungen durch de
- Seite 443 und 444:
„...die dominanteste Beeinträcht
- Seite 445 und 446:
Interpretation Person M Soziodemogr
- Seite 447 und 448:
aber ebenso wie sein Leben durch de
- Seite 449 und 450:
Zusammenfassung: Herr M. erzählt s
- Seite 451 und 452:
sich warten lassen...“ (ebd., 1)
- Seite 453 und 454:
„...dass ich nicht mehr so aggres
- Seite 455 und 456:
„...er möchte ins ambulant betre
- Seite 457 und 458:
Danach kam dann eine Zeit, in der e
- Seite 459 und 460:
Dort verbringt er nun die nächsten
- Seite 461 und 462:
Er musste also sein Zuhause verlass
- Seite 463 und 464:
Auffällig ist, dass er nicht von
- Seite 465 und 466:
eine wichtige Leistung ist oder Erf
- Seite 467 und 468:
die Scheidung dann zu Hause bin wie
- Seite 469 und 470:
Für die Zukunft plant Herr P., das
- Seite 471 und 472:
inwieweit sich das halt für ihn ir
- Seite 473 und 474:
Im Folgenden lernt seine Mutter ein
- Seite 475 und 476:
Trotz dieser doch sehr ausführlich
- Seite 477 und 478:
Bäcker um Frühstück zu holen und
- Seite 479 und 480:
geblieben bin mit dem auf die Yacht
- Seite 481 und 482:
Außerdem sieht er noch eine Entwic
- Seite 483 und 484:
„...es war dann auch so dass er..
- Seite 485 und 486:
unverständlich. Die Erzählung wir
- Seite 487 und 488:
20. Ergebnisse In diesem Kapitel m
- Seite 489 und 490:
Nun entsteht aber die Frage, wie di
- Seite 491 und 492:
getrunken worden wäre“, so entst
- Seite 493 und 494:
Punkte, die nur von den Therapeuten
- Seite 495 und 496:
„Was hat sich durch die Therapie
- Seite 497 und 498:
Es fällt auf, dass die Punkte wie
- Seite 499 und 500:
21. Erkenntnisse für die Soziother
- Seite 501 und 502:
Vertuschen, welches uns im soziothe
- Seite 503 und 504:
zum eingefleischten Habitus wird, e
- Seite 505 und 506:
22. Forschungsperspektiven Abschlie
- Seite 507 und 508:
23. Literaturverzeichnis A • Anon
- Seite 509 und 510:
• Babor, T. F., M. Hofmann, F. K.
- Seite 511 und 512:
• Blane, H. T., H. Barry (1973):
- Seite 513 und 514:
D • Cloninger, C. R. (1987): Rece
- Seite 515 und 516:
• Faris, A. A., M. G. Reyes, B. M
- Seite 517 und 518:
• Gavalar, J. S., D. D. van Thiel
- Seite 519 und 520:
• Helzer, J. E., T. R. Prybeck (1
- Seite 521 und 522:
I J • Huss, M. (1852): Chronische
- Seite 523 und 524:
• Karno, M., J. M. Golding, S. B.
- Seite 525 und 526:
Deutschland 2000. Deutsche Hauptsel
- Seite 527 und 528:
M • Littleton, J. M. (1989): Alco
- Seite 529 und 530:
N • Merkel, C. M. (1987): Zur Psy
- Seite 531 und 532:
• Pestalozzi, J. H. (1797): Meine
- Seite 533 und 534:
S • Rzany, B., E. G. Jung (1999):
- Seite 535 und 536:
• Sieg, I. , M. O. Doss (2000): A
- Seite 537 und 538:
T • Suter, P. M. (2000): Alkohol,
- Seite 539 und 540:
• Weiss, R. L: (1980): Strategic
- Seite 541 und 542:
24. Selbstständigkeitserklärung H
- Seite 543 und 544:
3.10.2004 Erlangung des akademische
- Seite 545 und 546:
545
- Seite 547 und 548:
ekommen habe; als ich den Führersc
- Seite 549 und 550:
A: und ich habe eine Freundin wiede
- Seite 551 und 552:
T: also kognitiv ist es bei ihm auf
- Seite 553 und 554:
Interview B B = interviewte Person
- Seite 555 und 556:
I: hm was ist da passiert? B: ich k
- Seite 557 und 558:
B: seit 2000, auch Leute aus der *L
- Seite 559 und 560:
B: bei mir verändert: - - - - äh
- Seite 561 und 562:
B: äh Zukunft ich möchte schon al
- Seite 563 und 564:
T: also ich habe am Anfang habe ich
- Seite 565 und 566:
Interview C C = Interviewte Person
- Seite 567 und 568:
dachte ich Mensch! man müsste doch
- Seite 569 und 570:
I: hm C: aber ich sehe irgendwie di
- Seite 571 und 572:
C: wissen Sie wenn ich mich jetzt m
- Seite 573 und 574:
I: ok was hat sich Deiner Meinung n
- Seite 575 und 576:
aufhören aber ich konnte es einfac
- Seite 577 und 578:
hochgekommen; und dann habe ich zur
- Seite 579 und 580:
alles scheißegal, ich habe in der
- Seite 581 und 582:
nicht mehr herausgekommen, so war e
- Seite 583 und 584:
Therapeuteninterview D T = intervie
- Seite 585 und 586:
(Versprecher) was ich mir noch vors
- Seite 587 und 588:
Therapie in *Würzburg - - ich konn
- Seite 589 und 590:
Therapeuteninterview E T = intervie
- Seite 591 und 592:
Interview F F = interviewte Person
- Seite 593 und 594:
I: hm F: ich habe nicht spucken kö
- Seite 595 und 596:
F: 98 war das also da war sie fix u
- Seite 597 und 598:
geschrieben ich weiß es nicht, als
- Seite 599 und 600:
T: also ganz starke kognitive Defiz
- Seite 601 und 602:
dann also nach der Therapie hatte i
- Seite 603 und 604:
G: und dann kam es eben auch dazu s
- Seite 605 und 606:
Therapeuteninterview G T=Interviewt
- Seite 607 und 608:
I: Stunden machen? T: also so gemei
- Seite 609 und 610:
geschmissen, mit achtzehn weil ich
- Seite 611 und 612:
Alkohol und was weiß ich und irgen
- Seite 613 und 614:
Therapeuteninterview H T = Intervie
- Seite 615 und 616:
Interview I IP = interviewte Person
- Seite 617 und 618:
Kasten geworden dann ein dreivierte
- Seite 619 und 620:
Therapeuteninterview I T = intervie
- Seite 621 und 622:
Interview J J = interviewte Person
- Seite 623 und 624:
Schlussstrich gezogen, während ich
- Seite 625 und 626:
J: ich meine die körperliche Verwa
- Seite 627 und 628:
Situation komme dass ich wieder vor
- Seite 629 und 630:
ganzen Mann gesehen hat; äh wie ge
- Seite 631 und 632:
Interview K K = interviewte Person
- Seite 633 und 634:
noch Schwierigkeiten das gebe ich e
- Seite 635 und 636:
fast nie etwas der merkt das gar ni
- Seite 637 und 638:
schon dass die Beziehung ich denke
- Seite 639 und 640:
hat sie dann äh ihren zweiten Mann
- Seite 641 und 642:
Interview L L = interviewte Person
- Seite 643 und 644:
übers Wochenende na ja die haben a
- Seite 645 und 646:
ich es mir richtig vorstelle und de
- Seite 647 und 648:
Therapeuteninterview L T = intervie
- Seite 649 und 650:
Interview M M = interviewte Person
- Seite 651 und 652:
Therapeuteninterview M T = intervie
- Seite 653 und 654:
Interview N N = interviewte Person
- Seite 655 und 656:
dass ich nicht mehr so aggressiv ei
- Seite 657 und 658:
verbirgt er auch viel, von seiner G
- Seite 659 und 660:
I: wo? O: im *Schönitz in München
- Seite 661 und 662:
verdiene ich am meisten Geld?´ ja
- Seite 663 und 664:
O: zu gehen und dann habe ich gesag
- Seite 665 und 666:
Therapeuteninterview O T=Interviewt
- Seite 667 und 668:
Interview P P = interviewte Person
- Seite 669 und 670:
P: also mir gefällt: eigentlich: j
- Seite 671 und 672:
Eindruck ähm er ist - - ausgeglich
- Seite 673 und 674:
Interview Q Q = interviewte Person
- Seite 675 und 676:
Staatssicherheit da, die hätten ih
- Seite 677 und 678:
der Technikerschule, dann habe ich
- Seite 679 und 680:
Q: und da war ich rechts: fast gel
- Seite 681 und 682:
und dann bin ich in ein Gasthaus we
- Seite 683 und 684:
Q: (es folgt eine unverständliche
- Seite 685 und 686:
sich um die Wohnung gekümmert Wäs
- Seite 687 und 688:
gesagt, so Ungerechtigkeiten, wenn
- Seite 689 und 690:
Therapeuteninterview Q T = intervie
- Seite 691 und 692:
also also Polyneuropathie ähm und
- Seite 693 und 694:
Internet www.ahg.de/ahgde.nsf/HTML/
- Seite 695 und 696:
So kann z. B. heute die kindliche L
- Seite 697 und 698:
Mögliche Verhaltensstörungen nach
- Seite 699 und 700:
REHA - ZENTRUM OBERPFALZ e.V. Stati
- Seite 701 und 702:
1 Zielgruppe 1.1 Indikation Aufgeno
- Seite 703 und 704:
3 Therapeutisches Angebot 3.1 Thera
- Seite 705 und 706:
• Abstinenzerprobung durch Tagesa
- Seite 707 und 708:
3.7 Sport- und Bewegungstherapie Di
- Seite 709 und 710:
6 Hausordnung 6.1 Grundregeln • D