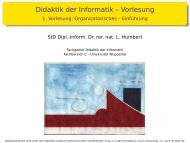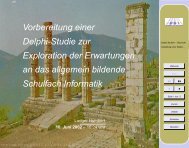Klassenbester in Deutsch oder Englisch? Nein danke – das passt ...
Klassenbester in Deutsch oder Englisch? Nein danke – das passt ...
Klassenbester in Deutsch oder Englisch? Nein danke – das passt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Verb<strong>in</strong>dung damit an der vorh<strong>in</strong> erwähnten häufigen Orientierung der Informatiklehrkräfte an<br />
den Vorkenntnissen der Jungen an (vgl. Mädchen und Computer 1992, S. 11), so<br />
dokumentiert sich auch <strong>in</strong> Informatik e<strong>in</strong>e Misserfolgsangst bei Mädchen. Gehen sie doch<br />
hier von e<strong>in</strong>em größeren Erfahrungsschatz der Jungen aus und davon, <strong>das</strong>s Jungen gleichfalls<br />
um ihre fachliche Überlegenheit wüssten und ihnen aus diesem Grund die fachliche Eignung<br />
absprächen. Schüler gehen mit diesem Selbst- und Fremdbild der Schüler<strong>in</strong>nen konform (vgl.<br />
Mädchen und Computer 1992, S. 14, S. 82). Die E<strong>in</strong>schätzung der <strong>in</strong>formationstechnischen<br />
Fähigkeiten beruht hierbei oftmals <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Überbewertung des eigenen Kenntnisstandes bei<br />
Jungen, während Mädchen ihre Kompetenzen selbst bei gleichem Wissensniveau ger<strong>in</strong>ger<br />
bewerten als die der Jungen. 202 Infolgedessen kommt es zur Entstehung von „Chef-<br />
Sekretär<strong>in</strong>- Rollenkonstellationen“, an denen die Schüler<strong>in</strong>nen auch willig mitwirken.<br />
Beispielsweise diktieren Schüler den Schüler<strong>in</strong>nen die e<strong>in</strong>zugebenden Daten und legen<br />
Prozedurnamen, Abkürzungen und Motive fest (vgl. Kreienbaum/ Metz-Göckel 1992, S. 87;<br />
vgl. dazu auch Mädchen und Computer 1992, S. 82). Halten wir uns die Bedeutsamkeit von<br />
Erfolg, Bestätigung durch andere, Selbstbestätigung sowie von dem (bereits im Kontext mit<br />
der Problematik des kognitiven Lernens erwähnten) <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>sisch motivierten Sach<strong>in</strong>teresse als<br />
„zentrale Lernmotive“ vor Augen 203 , so wird verständlich, wieso Schüler<strong>in</strong>nen, deren Klasse<br />
im Rahmen e<strong>in</strong>es Experimentes für die Durchführung e<strong>in</strong>es Computerkurses nach<br />
Geschlechtern getrennt wurde, sich <strong>in</strong> der geschlechtshomogenen Gruppe „sicherer fühlten“,<br />
„mehr Mut zum Ausprobieren hatten“, „Fehler selbst erkennen konnten“ und „mehr<br />
Selbstbestätigung bei erfolgreichen Arbeiten erfuhren“ (Mädchen und Computer 1992, S. 15).<br />
Im Umkehrschluss impliziert <strong>das</strong> aber für die koedukative Lernsituation entsprechend<br />
negative Auswirkungen auf die Lerne<strong>in</strong>stellung und <strong>das</strong> fachliche Selbstkonzept von<br />
Schüler<strong>in</strong>nen im H<strong>in</strong>blick auf die als „Jungenfach“ geltende Informatik.<br />
Fachliches Selbstkonzept und Lerne<strong>in</strong>stellung werden allerd<strong>in</strong>gs nicht nur durch die<br />
Interaktion der Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler untere<strong>in</strong>ander, sondern auch durch die Interaktion<br />
der Lernenden mit den Lehrenden geprägt. Nehmen doch <strong>in</strong>folge der bereits genannten<br />
Funktion des Geschlechtes als soziale Ordnungsgröße, mit der sich e<strong>in</strong> umfassender<br />
Interpretationskatalog verb<strong>in</strong>det, nicht nur SchülerInnen die Lehrkräfte <strong>in</strong> ihrer<br />
Geschlechtlichkeit wahr, sondern tun Lehrkräfte ihrerseits auch <strong>das</strong>selbe mit den<br />
Schüler<strong>in</strong>nen und Schülern. Hieraus ergeben sich z.B. unterschiedliche Erwartungen an die<br />
Mädchen und Jungen h<strong>in</strong>sichtlich ihrer fachlichen bzw. körperlichen Fähigkeiten, welche sich<br />
<strong>in</strong> Form von Zuschreibungen an die Geschlechter äußern. So schätzen, wie e<strong>in</strong>e Untersuchung<br />
zeigen konnte, Lehrer<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> Mathematik die Schüler<strong>in</strong>nen qua Geschlecht erheblich<br />
weniger begabt als Schüler e<strong>in</strong><strong>–</strong> <strong>das</strong> heißt, ihre Leistungserwartungen an Jungen s<strong>in</strong>d<br />
pr<strong>in</strong>zipiell höher. 204 Folgen wir den Ergebnissen der Studie von Jacobson und Rosenthal 205<br />
von 1971, so führen derlei Attribuierungen zum sogenannten „Pygmalion-Effekt“, nach dem<br />
die Erwartungshaltung e<strong>in</strong>er Lehrkraft e<strong>in</strong>en großen E<strong>in</strong>fluss auf die Lern- und<br />
Leistungsmotivation von SchülerInnen ausübt. Dies bedeutet, die SchülerInnen stellen sich<br />
mit der Zeit auf die an sie gerichteten hohen <strong>oder</strong> niedrigen Erwartungen der Lehrperson e<strong>in</strong><br />
und s<strong>in</strong>d -unabhängig von ihren tatsächlichen <strong>in</strong>tellektuellen Potentialen- entsprechend stark<br />
<strong>oder</strong> schwach ambitioniert. Das Phänomen der „sich selbst erfüllenden Prophezeiungen“ ist<br />
202 vgl. Fauser, R./ Schreiber, R. : Was erwarten Jugendliche und Erwachsene von <strong>in</strong>formationstechnischer<br />
Bildung? Ergebnisse e<strong>in</strong>er empirischen Untersuchung bei Familien mit K<strong>in</strong>dern <strong>in</strong> der 8. Schulklasse.<br />
Universität Konstanz: Konstanz 1988, S. 32ff, zitiert <strong>in</strong>: Heppner/ Osterhoff/ Schiersmann/ Schmidt 1990, S. 146<br />
f<br />
203 Glöckel, H.: Vom Unterricht. Lehrbuch der allgeme<strong>in</strong>en Didaktik. Verlag Julius Kl<strong>in</strong>khardt: Bad Heilbrunn/<br />
Obb. 1992, S. o. A.<br />
204 vgl. Beziehungsstrukturen <strong>in</strong> der Schule. E<strong>in</strong>e Untersuchung an hessischen Schulen im Auftrag des<br />
hessischen Instituts für Bildungsplanung und Schulentwicklung. Projektbericht, Frankfurt am Ma<strong>in</strong>/ Wiesbaden<br />
1988, zitiert <strong>in</strong>: Birmily/ Dablander/ Rosenbichler/ Vollmannn 1991, S. 70<br />
205 Rosenthal, R./ Jacobson, L.: Pygmalion im Unterricht. Beltz Verlag: We<strong>in</strong>heim 1971<br />
92