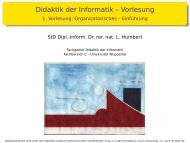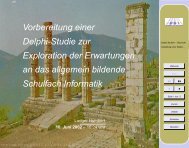- Seite 1:
Klassenbeste in Physik oder Informa
- Seite 6 und 7:
D. METHODISCHE BESCHREIBUNG DER STU
- Seite 8 und 9:
ANHANG 1 - DER FRAGEBOGEN .........
- Seite 10 und 11:
Ausbildungs- und Studienwahl so sel
- Seite 12 und 13:
den beruflichen „Männerdomänen
- Seite 14 und 15:
sozialwissenschaftliche Befragungen
- Seite 16 und 17:
Mayer/ Rabe-Kleberg 1985, Küllchen
- Seite 18 und 19:
B. Zeitgeschichtlicher Kontext der
- Seite 20 und 21:
demografische Situation zeigt. Ande
- Seite 22 und 23:
Umstrukturierungen betroffenen Män
- Seite 24 und 25:
ehemaligen DDR zum sozialistischen
- Seite 26 und 27:
HIS-Studie verschiedene Aspekte der
- Seite 28 und 29:
und 1998 54% 61 der Mädchen auf di
- Seite 30 und 31:
Tabelle 1a): Die 20 am stärksten m
- Seite 32 und 33:
Tabelle 2a): Die 20 am stärksten m
- Seite 34 und 35:
Tabelle 4: Die 10 am stärksten mit
- Seite 36 und 37: zwischen 40 bis 60% bewegt (IAB Kur
- Seite 38 und 39: Abbildung 2: Der Anteil weiblicher
- Seite 40 und 41: Abbildung 3: Entwicklung des Frauen
- Seite 42 und 43: Tabelle 6: Die 10 am stärksten von
- Seite 44 und 45: Resümierend lässt sich anhand der
- Seite 46 und 47: geschafft, konnten dieses Prädikat
- Seite 48 und 49: Fachhochschulen Frauen in den „In
- Seite 50 und 51: Stattdessen nehmen Germanistik, Erz
- Seite 52 und 53: Klar aus der (im Rahmen des letzten
- Seite 54 und 55: C.2. Charakteristika von sogenannte
- Seite 56 und 57: „geschlechtstypischen“ Berufen
- Seite 58 und 59: Tabelle 12: Verhältnis der Frauenv
- Seite 60 und 61: das Arbeitsleben ungünstig bündel
- Seite 62 und 63: Weiterhin spielen der „…Verlust
- Seite 64 und 65: Thema der „Gewährung“ 114 von
- Seite 66 und 67: Anzahl von das Berufsfachschulsyste
- Seite 68 und 69: Abbildung 8: Der Anteil an weiblich
- Seite 70 und 71: Elektrotechnik (mit 14,6%) (vgl. IA
- Seite 72 und 73: Prozess der kindlichen Sozialisatio
- Seite 74 und 75: ,Ausreichend’ im Fach Deutsch zu
- Seite 76 und 77: „geschlechtsspezifischen“ Sozia
- Seite 78 und 79: Tabelle 13: Motive für die gewüns
- Seite 80 und 81: etwas weniger, aber dennoch hohen Z
- Seite 82 und 83: Williams/ Mc Cullers (1983) 151 : M
- Seite 84 und 85: Intensität der Orientierung an soz
- Seite 88 und 89: Bildungschancen für beide Geschlec
- Seite 90 und 91: Kompetenzen der jungen Frauen zur B
- Seite 92 und 93: Sport Latein Sozialwissenschaft Kun
- Seite 94 und 95: Mädchen präsent, was sich in Erdk
- Seite 96 und 97: Kompetenzen für berufliche Zwecke
- Seite 98 und 99: Kopplung einer Schulaufgabe an die
- Seite 100 und 101: Verbindung damit an der vorhin erw
- Seite 102 und 103: Feather und Simon 209 konnten aus d
- Seite 104 und 105: fachliche Aufgabenverteilung und Hi
- Seite 106 und 107: D. Methodische Beschreibung der Stu
- Seite 108 und 109: - die (erhebungswellenanzahlbegrün
- Seite 110 und 111: 1992, S. 180). Die Bundeslandzugeh
- Seite 112 und 113: gegebenen spezifischen Untersuchung
- Seite 114 und 115: Variable der Studie, der die Befrag
- Seite 116 und 117: Angaben aus Gründen mangelnder Kom
- Seite 118 und 119: 0421333172-m (für Realschüler der
- Seite 120 und 121: Durch die Einbindung von Kontaktbö
- Seite 122 und 123: Beantwortung des Fragebogens nieder
- Seite 124 und 125: Theoretischer Ansatz der Studie Das
- Seite 126 und 127: - Fachliche Diskriminierung durch K
- Seite 128 und 129: - eigenes Durchsetzungsvermögen ge
- Seite 130 und 131: sowie b) der „Körperlichen Sozia
- Seite 132 und 133: ausgeschlossen werden. Dasselbe gal
- Seite 134 und 135: E. Inhaltliche Auswertung der Befra
- Seite 136 und 137:
3. polarisierten die fragebogenimma
- Seite 138 und 139:
„Wie kommen Sie eigentlich zu der
- Seite 140 und 141:
E.1.2. Inhaltsanalytische Auswertun
- Seite 142 und 143:
Schuljahr verschobene Teilnahme zu
- Seite 144 und 145:
E.2. Hauptstudie E.2.1. Inhaltsanal
- Seite 146 und 147:
(6) keine Teilnahme, „weil unsere
- Seite 148 und 149:
(16)-(18): auf dem Anrufbeantworter
- Seite 150 und 151:
Klassifizierungsmerkmales „Konkre
- Seite 152 und 153:
Durchführung der Befragung erwogen
- Seite 154 und 155:
Brosius bewertet die dargestellte K
- Seite 156 und 157:
Nachfolgend gelten diese Abkürzung
- Seite 158 und 159:
etwa gleichem Niveau). An der Reals
- Seite 160 und 161:
interessantesten ein. Das uneingesc
- Seite 162 und 163:
schulformspezifische Betrachtung de
- Seite 164 und 165:
für Informatik sein muss, zeigt da
- Seite 166 und 167:
Zwischen der Deutschnote und der Au
- Seite 168 und 169:
„st. größtenteils nicht“: Mä
- Seite 170 und 171:
Zwischen der subjektiv vermuteten L
- Seite 172 und 173:
Zwischen der Aussage, aufgrund der
- Seite 174 und 175:
Mit 89% bzw. 84% gingen Mädchen bz
- Seite 176 und 177:
Zwischen der subjektiv vermuteten L
- Seite 178 und 179:
Mädchen: Kendall-Tau-b: 0,412** Si
- Seite 180 und 181:
Jungen: Kendall-Tau-b: -0,117** Sig
- Seite 182 und 183:
Demnach lehnen 58% der Mädchen, ab
- Seite 184 und 185:
Mädchen: Kendall-Tau-b: 0,367** Si
- Seite 186 und 187:
„st. größtenteils nicht“: Mä
- Seite 188 und 189:
Zwischen dem diskutierten Item und
- Seite 190 und 191:
Mädchen: Kendall-Tau-b: -0,070* Si
- Seite 192 und 193:
diese Fachgebiete, bestand bei beid
- Seite 194 und 195:
Jungen: HS: 15,4% RS: 11,2% Ges: 17
- Seite 196 und 197:
„meistens von Direktoren“: Mä:
- Seite 198 und 199:
Zwischen dem diskutierten Item und
- Seite 200 und 201:
„manchmal“: Mä: 19,9%; Ju: 26,
- Seite 202 und 203:
Zwischen dem diskutierten Item und
- Seite 204 und 205:
Die überwältigende Mehrheit von 8
- Seite 206 und 207:
Gesamtschüler mit ihrem im Schulfo
- Seite 208 und 209:
und bei Jungen die folgende positiv
- Seite 210 und 211:
Zwischen dem diskutierten Item und
- Seite 212 und 213:
Zwischen dem diskutierten Item und
- Seite 214 und 215:
Zwischen dem diskutierten Item und
- Seite 216 und 217:
Jungen: HS: 11,4% RS: 6,0% Ges: 7,3
- Seite 218 und 219:
Jungen: Kendall-Tau-b: 0,216** Sign
- Seite 220 und 221:
Nur ein Drittel der Schülerinnen,
- Seite 222 und 223:
Körperliche Sozialisation durch de
- Seite 224 und 225:
Zwischen dem diskutierten Item und
- Seite 226 und 227:
Weniger als 1/3 der Schülerinnen,
- Seite 228 und 229:
schulformspezifische Betrachtung de
- Seite 230 und 231:
Sexuelle Belästigung von Mädchen
- Seite 232 und 233:
Zwischen dem diskutierten Item und
- Seite 234 und 235:
Zwischen dem diskutierten Item und
- Seite 236 und 237:
Bei diesem Item gleicht sich die Ei
- Seite 238 und 239:
Zwischen dem diskutierten Item und
- Seite 240 und 241:
Zwischen dem diskutierten Item und
- Seite 242 und 243:
Schulische Hilfestellungen bei der
- Seite 244 und 245:
Zwischen dem diskutierten Item und
- Seite 246 und 247:
E.2.2.c. Die Berufswahlentscheidung
- Seite 248 und 249:
Schulkameradinnen belief sich diese
- Seite 250 und 251:
E.2.3. Typologisierung Die Typologi
- Seite 252 und 253:
Deutsch, Fremdsprachen oder Biologi
- Seite 254 und 255:
gegebenenfalls die subjektive Erfah
- Seite 256 und 257:
E.2.4. Zusammenfassung der empirisc
- Seite 258 und 259:
- der Auffassung, für die Ausübun
- Seite 260 und 261:
- der Auffassung, vom Wesen her sei
- Seite 262 und 263:
eines Bezuges des Informatik-, Tech
- Seite 264 und 265:
Annahmen einer auch zu Koedukations
- Seite 266 und 267:
eiderlei Geschlechts mit dem hohen
- Seite 268 und 269:
zw. in vielen „Männerberufen“
- Seite 270 und 271:
für den Beruf zweifelnden Kollegin
- Seite 272 und 273:
engeren, begrenzteren Zusammenhang
- Seite 274 und 275:
Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt vorb
- Seite 276 und 277:
Damit ist der institutionsbezogene,
- Seite 278 und 279:
Hauptschulen, eine Realschule, zwei
- Seite 280 und 281:
Verbindung mit der auf jugendliche
- Seite 282 und 283:
quantitativen Pretestanalyse siehe
- Seite 284 und 285:
Als unangebracht groß stuften ledi
- Seite 286 und 287:
c) „Ich möchte meinen Steckbrief
- Seite 288 und 289:
Schulfächer) enthielten oder -in A
- Seite 290 und 291:
zugehörig sind eigens für die Sch
- Seite 292 und 293:
Wenden wir uns nun von den institut
- Seite 294 und 295:
2. / 22 12 1 1 / 3 / / / / 2 / 3. T
- Seite 296 und 297:
sowie die bei 40 Prozent liegenden
- Seite 298 und 299:
verwendeten Informatikunterricht zu
- Seite 300 und 301:
häufig 320 über Email realisiert;
- Seite 302 und 303:
Verbindung mit den den jeweiligen D
- Seite 304 und 305:
In der Hauptstudie gaben lediglich
- Seite 306 und 307:
F.2.4. Zusammenfassung der methodis
- Seite 308 und 309:
auf die Eigenheiten des Mediums WWW
- Seite 310 und 311:
1994, S. 19). In unserer heutigen Z
- Seite 312 und 313:
durch die Suche nach der eigenen Ge
- Seite 314 und 315:
Schuljahresende ein spezieller Raum
- Seite 316 und 317:
gerade in den kulturell als geschle
- Seite 318 und 319:
Nachnamens; bei der nächsten Aufga
- Seite 320 und 321:
trainieren. Solch eine identische F
- Seite 322 und 323:
sowie ihr Fremdbild vom anderen Ges
- Seite 324 und 325:
subsumierbar sind, da ihr „…Aus
- Seite 326 und 327:
- der Anteil an Vätern, welche die
- Seite 328 und 329:
„Männer-“ und „Frauenberufe
- Seite 330 und 331:
Mittelfristig zu überdenken bleibt
- Seite 332 und 333:
G.2. Bildungspolitische Schlussfolg
- Seite 334 und 335:
Pädagogische Bemühungen sollten s
- Seite 336 und 337:
Vielfalt bildungspolitisch zur Entw
- Seite 338 und 339:
stilistischen Mittel zu bedenken, d
- Seite 340 und 341:
d) „die Software-Freaks“ (ohne
- Seite 342 und 343:
- ins Anschreiben integrierter expl
- Seite 344 und 345:
- Eine Identifikation während eine
- Seite 346 und 347:
ähnliche Gründe die Teilnahmebere
- Seite 348 und 349:
Durchführung der Befragung (1) Ver
- Seite 350 und 351:
einzelnen Fragenteile aufeinander
- Seite 352 und 353:
verschiedenen Schulformen), können
- Seite 354 und 355:
Nutzung von Java Script könnte des
- Seite 356 und 357:
Fragen mit gleichförmigen Antworts
- Seite 358 und 359:
noch auszufüllen sind. Dabei sollt
- Seite 360 und 361:
Sinne ihrer Erkennbarkeit als Anfü
- Seite 362 und 363:
[14] Bertram, Barbara/ Bertram, Han
- Seite 364 und 365:
Deutschland 1945- 1992. Schriftenre
- Seite 366 und 367:
[78] Heppner, G./ Osterhoff, J./ Sc
- Seite 368 und 369:
[108] Kreft, Dieter/ Mielenz, Ingri
- Seite 370 und 371:
[137] Neumann, Lothar F./ Schaper,
- Seite 372 und 373:
[165] Valtin, Renate/ Warm, Ute (Hg
- Seite 374 und 375:
Jungenfragebogen: Die in der Schule
- Seite 376 und 377:
Erklärung zu den folgenden beiden
- Seite 378 und 379:
41. Beide: Viele Frauenberufe erfor
- Seite 380 und 381:
ANHANG 2 - Erklärung der in den Di
- Seite 382 und 383:
DFB-Lehrer: Eignungsbeweis Geschlec
- Seite 384 und 385:
"Frauenberufe": ästhetikbetont: Ei
- Seite 386 und 387:
ANHANG 3 - Diagramme zu den empiris
- Seite 388 und 389:
Schuldirektor: Eignung qua Geschlec
- Seite 390 und 391:
400 300 200 100 Geschlecht Anzahl 0
- Seite 392 und 393:
300 200 100 Geschlecht Anzahl 0 Wei
- Seite 394 und 395:
300 200 100 Geschlecht Anzahl 0 Wei
- Seite 396 und 397:
300 200 100 Geschlecht Anzahl 0 Wei
- Seite 398 und 399:
300 200 100 Geschlecht Anzahl 0 Wei
- Seite 400 und 401:
300 200 100 Geschlecht Anzahl 0 Wei
- Seite 402 und 403:
300 200 100 Geschlecht Anzahl 0 Wei
- Seite 404 und 405:
200 180 160 140 120 100 Anzahl 80 6
- Seite 406 und 407:
300 200 100 Geschlecht Anzahl 0 Wei
- Seite 408 und 409:
300 200 100 Geschlecht Anzahl 0 Wei
- Seite 410 und 411:
400 300 200 100 Geschlecht Anzahl 0
- Seite 412 und 413:
400 300 200 100 Geschlecht Anzahl 0
- Seite 414 und 415:
200 100 Geschlecht Anzahl 0 Weiblic
- Seite 416 und 417:
300 200 100 Geschlecht Anzahl 0 Wei
- Seite 418 und 419:
300 200 100 Geschlecht Anzahl 0 Wei
- Seite 420 und 421:
400 300 200 100 Geschlecht Anzahl 0
- Seite 422 und 423:
300 200 100 Geschlecht Anzahl 0 Wei
- Seite 424 und 425:
300 200 100 Geschlecht Anzahl 0 Wei
- Seite 426 und 427:
300 200 100 Geschlecht Anzahl 0 Wei
- Seite 428 und 429:
400 300 200 100 Geschlecht Anzahl 0
- Seite 430 und 431:
422
- Seite 432 und 433:
ANHANG 6 - Auszüge aus dem grafisc
- Seite 434 und 435:
426
- Seite 436 und 437:
Fragebogen (Auszug) 428
- Seite 438 und 439:
430
- Seite 440 und 441:
432
- Seite 442 und 443:
434
- Seite 444:
436