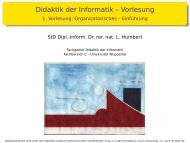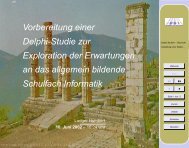Klassenbester in Deutsch oder Englisch? Nein danke – das passt ...
Klassenbester in Deutsch oder Englisch? Nein danke – das passt ...
Klassenbester in Deutsch oder Englisch? Nein danke – das passt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bildungschancen für beide Geschlechter durch die gemischtgeschlechtliche Schule ergeben<br />
und die da wären:<br />
- die Vermittlung identischer (statt geschlechtergetrennter) Bildungs<strong>in</strong>halte und damit<br />
der Aufbau gleicher Wissensbestände bzw. die Ausbildung derselben Fähigkeiten und<br />
Fertigkeiten (natürlich nicht generell für alle -<strong>in</strong>tellektuell und begabungsmäßig doch<br />
sehr unterschiedlich beschaffen se<strong>in</strong> könnenden- Individuen, wohl aber für die beiden<br />
sozialen Großgruppen der Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler)<br />
- die Herausbildung e<strong>in</strong>es primär an Kompetenz- und Leistungskriterien (und nicht<br />
mehr wie zu vor-koedukativen Zeiten vorrangig an Geschlechterbildern) orientierten<br />
fachlichen wie sozialen Selbstkonzeptes bei Mädchen und Jungen<br />
- <strong>das</strong> pädagogische Bemühen um e<strong>in</strong>e Ausrichtung des ,geme<strong>in</strong>samen Interagierens’ der<br />
Jungen und Mädchen am Pr<strong>in</strong>zip der Kameradschaft als Fundament e<strong>in</strong>er<br />
funktionstüchtigen Klassengeme<strong>in</strong>schaft<br />
Vergegenwärtigen wir uns, um e<strong>in</strong>er Erklärung für den genannten Widerspruch e<strong>in</strong> wenig<br />
näher zu kommen, zuerst die Voraussetzungen, die der Schule aus ihrer geschichtlichen und<br />
gegenwärtigen Rolle erwachsen, und skizzieren wir kurz den historischen Ursprung der<br />
Schule als Institution. „Term<strong>in</strong>iert man den Beg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>es organisierten höheren Schulwesens<br />
auf die griechische Antike…“ -im Zusammenhang damit, <strong>das</strong>s der griechische Humanismus<br />
als e<strong>in</strong>e der drei Wurzeln der europäischen Tradition gilt und ihm <strong>das</strong> Menschenbild vom<br />
gebildeten, se<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tellektuellen Fähigkeiten und somit se<strong>in</strong>e Persönlichkeit<br />
vervollkommnenden Manne zugrunde liegt 173 - „…, so war hier der Schulweg für die<br />
Mädchen um etwa 2000 Jahre länger, bis sie um m<strong>in</strong>destens 1900 n. Chr. den E<strong>in</strong>gang <strong>in</strong> die<br />
Höheren Schulen fanden.“ (Liedtke 1990, S. 25) Da die antike griechische Idealvorstellung<br />
des gebildeten -männlichen und freien (unversklavten)- Menschen sich aber mit der konkreten<br />
Zielstellung der Bewältigung gesellschaftlicher Aufgaben (etwa im Rechtswesen, der Politik<br />
<strong>oder</strong> gehobeneren Positionen <strong>in</strong> der Armee) durch den hierzu nun über <strong>das</strong> nötige geistige<br />
Handwerkszeug verfügenden Mann verband 174 , bestand die historisch begründete Funktion<br />
der Schule also <strong>in</strong> der Vorbereitung auf den E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> <strong>das</strong> öffentliche -bereits berufsbildartig<br />
strukturierte- Leben. Weil dieser öffentliche Bereich jedoch <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie maskul<strong>in</strong> war,<br />
erhielten Mädchen bzw. Frauen folglich gar ke<strong>in</strong>e Schulbildung, was bis zum 19. Jahrhundert<br />
so blieb. Mit der Industrialisierung entstand die m<strong>oder</strong>ne westliche Schulbildung als<br />
-nunmehr allen Schichten offenstehende- notwendig gewordene Kopplung zwischen den sich<br />
zunehmend mehr vone<strong>in</strong>ander lösenden Bereichen von Produktion und Reproduktion (vgl.<br />
Berner 1987, S. 7). Gleich den Jungen erhielten Mädchen aus der Arbeiterklasse jetzt e<strong>in</strong>e<br />
rudimentäre Schulbildung, welche sie zur Aufnahme e<strong>in</strong>er Arbeit <strong>in</strong> Industrie, Landwirtschaft<br />
<strong>oder</strong> Haushalt befähigen sollte (vgl. ebd.). Für die weiblichen Angehörigen der Mittelschicht<br />
aber wurden die „Höheren Mädchenschulen“ geschaffen, welche auf e<strong>in</strong> Wirken ihrer<br />
Zögl<strong>in</strong>ge als Hausfrau, Gatt<strong>in</strong> und Mutter h<strong>in</strong>arbeiteten. Somit wurde „…e<strong>in</strong>e über die<br />
Elementarbildung h<strong>in</strong>ausgehende höhere Bildung von Jungen und Mädchen<br />
geschlechtsspezifisch differenziert…“ und die Schulbildung war für Mädchen ke<strong>in</strong>e „…am<br />
klassischen Bildungskanon orientierte sogenannte Allgeme<strong>in</strong>bildung…“, sondern stattdessen<br />
e<strong>in</strong>e spezifische Mädchenbildung 175 (vgl. auch ebd.). Die Schulfächer Naturwissenschaften<br />
und Mathematik g<strong>in</strong>gen mit der an den Höheren Mädchenschulen vermittelten „weiblichen<br />
Bestimmung“ nicht sonderlich konform und wurden hier nur entsprechend schmalspurig<br />
gelehrt (vgl. ebd.). Wie sich zeigt, steht <strong>das</strong> Schulwesen also <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bestimmten<br />
geschlechterhierarchisierenden Tradition. Damit offenbart sich gleichfalls, <strong>das</strong>s Bildung und<br />
Arbeit -gerade auch die Arbeit <strong>in</strong> technischen Berufen- auf historisch entwickelten<br />
173 vgl. Cartou, Louis: La tradition européenne. Les sources de la tradition européenne., S. 4. In: Cartou, Louis:<br />
L’Union européenne. Traités de Paris-Rome-Maastricht. 2 ème édition, DALLOZ: o.A. 1996, S. 3-29<br />
174 vgl. ebd.<br />
175 Jacobi 1997, S. 268<br />
80