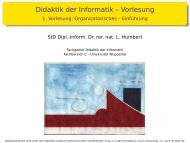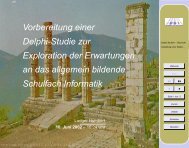Klassenbester in Deutsch oder Englisch? Nein danke – das passt ...
Klassenbester in Deutsch oder Englisch? Nein danke – das passt ...
Klassenbester in Deutsch oder Englisch? Nein danke – das passt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
etwas weniger, aber dennoch hohen Zuspruch von beiden Geschlechtern erfährt -also von<br />
Mädchen nicht <strong>in</strong> maßgeblich höherem Ausmaß als von Jungen bestätigt wird. Das dürfte als<br />
e<strong>in</strong> H<strong>in</strong>weis auf e<strong>in</strong>e Abkehr von sich für „Männerberufe“ <strong>in</strong>teressierenden Mädchen von<br />
Geschlechterstereotypen zu <strong>in</strong>terpretieren se<strong>in</strong>, die als Voraussetzung für Mädchen zur Wahl<br />
eben dieser Berufe schlüssig anmutet. Dass diese Loslösung von herkömmlichen<br />
Geschlechtsrollenvorgaben sich nicht vollständig vollzogen haben muss, um <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en<br />
„Männerberuf“ e<strong>in</strong>münden zu wollen, beweist <strong>das</strong> Item „recht viel Geld verdienen“, welches<br />
20% weniger Mädchen als Jungen als ausschlaggebende Komponente für die<br />
Ausbildungswahl bejahen (damit fällt ihre Zustimmung zu diesem Item allerd<strong>in</strong>gs trotzdem<br />
noch wesentlich höher aus als die der Studienanfänger<strong>in</strong>nen und weiblichen<br />
Studienberechtigten hierzu). 146 Das Item zum aus dem Beruf gewonnenen sozialen Prestige<br />
soll an dieser Stelle -wenngleich der Vollständigkeit halber <strong>in</strong> Anlehnung an Tabelle 13<br />
erwähnt- nicht ausführlicher diskutiert werden, weil <strong>in</strong> der Fragestellung zu diesem Item <strong>in</strong><br />
den Tabellen 13 und 14 unterschiedliche Sachverhalte zum Tragen kommen. So fragt <strong>das</strong><br />
Item der Tabelle 13 „hohen sozialen Status erlangen“ <strong>das</strong> gesellschaftliche Renommee des<br />
Berufsstandes ab, währenddessen Tabelle 14 mit ihrem Item „durch den Beruf hohes Ansehen<br />
bei Freunden und Bekannten haben“ vielmehr auf die antizipierte, durch die soziale Umwelt<br />
zu erfahrende Anerkennung der Berufs<strong>in</strong>haber<strong>in</strong> bzw. des Berufs<strong>in</strong>habers (also der<br />
TrägerInnen e<strong>in</strong>er Berufsrolle) abzielt. Bei letzterem Item wurde also nicht der eigene<br />
Wunsch zur Herstellung von gesellschaftlichem Status erfragt, sondern stattdessen die (auch<br />
<strong>in</strong> der hier vorgelegten Forschungsarbeit empirisch untersuchte) ke<strong>in</strong>eswegs realitätsfremde<br />
E<strong>in</strong>schätzung der unterschiedlichen Reaktionen der sozialen Umgebung auf die Präsenz von<br />
Jungen <strong>oder</strong> Mädchen <strong>in</strong> „Männerberufen“ zum Befragungsgegenstand gemacht, woraus sich<br />
der um 20% höhere (und damit im Verhältnis zu den Mädchen fast doppelt so hohe)<br />
Prozentsatz der Jungen bei der Zustimmung zu e<strong>in</strong>em beruflich vermittelten Prestigegew<strong>in</strong>n<br />
bei Freunden <strong>oder</strong> Bekannten erklärt. E<strong>in</strong>e letzte Bemerkung zur Tabelle 14 sei im H<strong>in</strong>blick<br />
auf die (den Mädchen vergleichbare) hohe Zustimmung der Jungen zum<br />
Ausbildungswahlmotiv „anderen Menschen helfen“ gemacht. Diese Angabe steht zu den<br />
Ergebnissen der Tabelle 13, die e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Betonung affektiver E<strong>in</strong>stellungen von Männern<br />
bei der Studienfachwahl dokumentierte, im Widerspruch, der anhand re<strong>in</strong> quantitativer Daten<br />
nicht e<strong>in</strong>deutig zu klären ist. Als mögliche Ursachen kommen beispielsweise <strong>in</strong> Frage:<br />
• e<strong>in</strong>e generelle Abnahme altruistischer Ambitionen gegen Ende des zwanzigsten<br />
Jahrhunderts im Zuge e<strong>in</strong>er sich von solidarischen Pr<strong>in</strong>zipien zunehmend<br />
distanzierenden gesellschaftlichen Entwicklung, denn die Werte zum W<strong>in</strong>tersemester<br />
1989/90, zum W<strong>in</strong>tersemester 1996/97 bzw. zum Jahr 1996 lagen auch bei den Frauen<br />
wesentlich niedriger als bei den Jungen <strong>in</strong> „Männerberufen“ im Jahr 1985<br />
• e<strong>in</strong> Abs<strong>in</strong>ken am Geme<strong>in</strong>wohl orientierter Bestrebungen mit zunehmendem<br />
Lebensalter<br />
• <strong>das</strong>s mit zunehmendem Bildungsgrad 147 bestimmte Aspekte des traditionellen<br />
Geschlechterbildes an Verb<strong>in</strong>dlichkeit gew<strong>in</strong>nen, womit sich die<br />
geschlechtsrollenkonformere Motivstruktur der Studierenden bzw.<br />
Studienberechtigten gegenüber den Auszubildenden <strong>in</strong> „Männerberufen“ erklärt (was<br />
gängigen Annahmen über e<strong>in</strong>e mit dem Bildungszuwachs e<strong>in</strong>hergehende generell<br />
größere Abkehr von geschlechtsrollenbezogenen Normen widerspräche)<br />
146 Beachtlicherweise wächst die Zustimmung zu diesem Item jedoch kurz nach Ausbildungsabschluss bei<br />
Mädchen um ganze 14% und bei Jungen nur um 3% (vgl. Kraft 1985, S. 9), was sich <strong>in</strong> der Zwischenzeit<br />
ereignet habende <strong>in</strong>teressante Effekte beruflicher Sozialisation nahe legt.<br />
147 Diese Argumentation würde auf e<strong>in</strong>er Vernachlässigung des „Fahrstuhleffektes“ beruhen, nach dem<br />
AbiturientInnen mit zunehmender Häufigkeit nicht nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Studium, sondern gleichfalls <strong>in</strong> Ausbildungsberufe<br />
e<strong>in</strong>münden.<br />
72