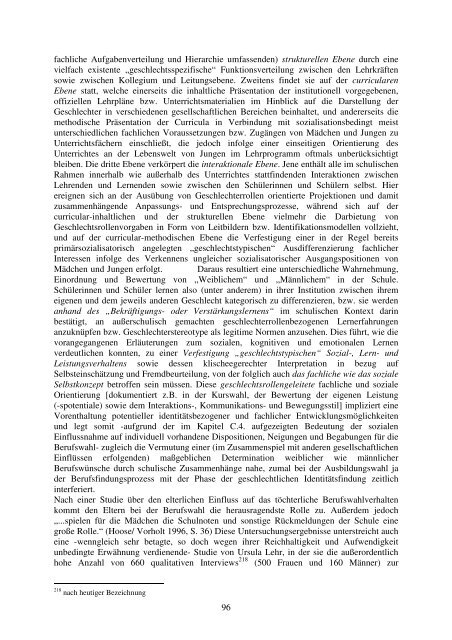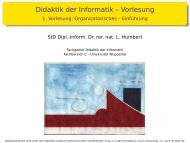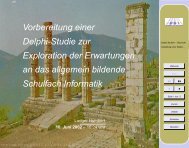Klassenbester in Deutsch oder Englisch? Nein danke – das passt ...
Klassenbester in Deutsch oder Englisch? Nein danke – das passt ...
Klassenbester in Deutsch oder Englisch? Nein danke – das passt ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
fachliche Aufgabenverteilung und Hierarchie umfassenden) strukturellen Ebene durch e<strong>in</strong>e<br />
vielfach existente „geschlechtsspezifische“ Funktionsverteilung zwischen den Lehrkräften<br />
sowie zwischen Kollegium und Leitungsebene. Zweitens f<strong>in</strong>det sie auf der curricularen<br />
Ebene statt, welche e<strong>in</strong>erseits die <strong>in</strong>haltliche Präsentation der <strong>in</strong>stitutionell vorgegebenen,<br />
offiziellen Lehrpläne bzw. Unterrichtsmaterialien im H<strong>in</strong>blick auf die Darstellung der<br />
Geschlechter <strong>in</strong> verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen be<strong>in</strong>haltet, und andererseits die<br />
methodische Präsentation der Curricula <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit sozialisationsbed<strong>in</strong>gt meist<br />
unterschiedlichen fachlichen Voraussetzungen bzw. Zugängen von Mädchen und Jungen zu<br />
Unterrichtsfächern e<strong>in</strong>schließt, die jedoch <strong>in</strong>folge e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>seitigen Orientierung des<br />
Unterrichtes an der Lebenswelt von Jungen im Lehrprogramm oftmals unberücksichtigt<br />
bleiben. Die dritte Ebene verkörpert die <strong>in</strong>teraktionale Ebene. Jene enthält alle im schulischen<br />
Rahmen <strong>in</strong>nerhalb wie außerhalb des Unterrichtes stattf<strong>in</strong>denden Interaktionen zwischen<br />
Lehrenden und Lernenden sowie zwischen den Schüler<strong>in</strong>nen und Schülern selbst. Hier<br />
ereignen sich an der Ausübung von Geschlechterrollen orientierte Projektionen und damit<br />
zusammenhängende Anpassungs- und Entsprechungsprozesse, während sich auf der<br />
curricular-<strong>in</strong>haltlichen und der strukturellen Ebene vielmehr die Darbietung von<br />
Geschlechtsrollenvorgaben <strong>in</strong> Form von Leitbildern bzw. Identifikationsmodellen vollzieht,<br />
und auf der curricular-methodischen Ebene die Verfestigung e<strong>in</strong>er <strong>in</strong> der Regel bereits<br />
primärsozialisatorisch angelegten „geschlechtstypischen“ Ausdifferenzierung fachlicher<br />
Interessen <strong>in</strong>folge des Verkennens ungleicher sozialisatorischer Ausgangspositionen von<br />
Mädchen und Jungen erfolgt. Daraus resultiert e<strong>in</strong>e unterschiedliche Wahrnehmung,<br />
E<strong>in</strong>ordnung und Bewertung von „Weiblichem“ und „Männlichem“ <strong>in</strong> der Schule.<br />
Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler lernen also (unter anderem) <strong>in</strong> ihrer Institution zwischen ihrem<br />
eigenen und dem jeweils anderen Geschlecht kategorisch zu differenzieren, bzw. sie werden<br />
anhand des „Bekräftigungs- <strong>oder</strong> Verstärkungslernens“ im schulischen Kontext dar<strong>in</strong><br />
bestätigt, an außerschulisch gemachten geschlechterrollenbezogenen Lernerfahrungen<br />
anzuknüpfen bzw. Geschlechterstereotype als legitime Normen anzusehen. Dies führt, wie die<br />
vorangegangenen Erläuterungen zum sozialen, kognitiven und emotionalen Lernen<br />
verdeutlichen konnten, zu e<strong>in</strong>er Verfestigung „geschlechtstypischen“ Sozial-, Lern- und<br />
Leistungsverhaltens sowie dessen klischeegerechter Interpretation <strong>in</strong> bezug auf<br />
Selbste<strong>in</strong>schätzung und Fremdbeurteilung, von der folglich auch <strong>das</strong> fachliche wie <strong>das</strong> soziale<br />
Selbstkonzept betroffen se<strong>in</strong> müssen. Diese geschlechtsrollengeleitete fachliche und soziale<br />
Orientierung [dokumentiert z.B. <strong>in</strong> der Kurswahl, der Bewertung der eigenen Leistung<br />
(-spotentiale) sowie dem Interaktions-, Kommunikations- und Bewegungsstil] impliziert e<strong>in</strong>e<br />
Vorenthaltung potentieller identitätsbezogener und fachlicher Entwicklungsmöglichkeiten<br />
und legt somit -aufgrund der im Kapitel C.4. aufgezeigten Bedeutung der sozialen<br />
E<strong>in</strong>flussnahme auf <strong>in</strong>dividuell vorhandene Dispositionen, Neigungen und Begabungen für die<br />
Berufswahl- zugleich die Vermutung e<strong>in</strong>er (im Zusammenspiel mit anderen gesellschaftlichen<br />
E<strong>in</strong>flüssen erfolgenden) maßgeblichen Determ<strong>in</strong>ation weiblicher wie männlicher<br />
Berufswünsche durch schulische Zusammenhänge nahe, zumal bei der Ausbildungswahl ja<br />
der Berufsf<strong>in</strong>dungsprozess mit der Phase der geschlechtlichen Identitätsf<strong>in</strong>dung zeitlich<br />
<strong>in</strong>terferiert.<br />
Nach e<strong>in</strong>er Studie über den elterlichen E<strong>in</strong>fluss auf <strong>das</strong> töchterliche Berufswahlverhalten<br />
kommt den Eltern bei der Berufswahl die herausragendste Rolle zu. Außerdem jedoch<br />
„...spielen für die Mädchen die Schulnoten und sonstige Rückmeldungen der Schule e<strong>in</strong>e<br />
große Rolle.“ (Hoose/ Vorholt 1996, S. 36) Diese Untersuchungsergebnisse unterstreicht auch<br />
e<strong>in</strong>e -wenngleich sehr betagte, so doch wegen ihrer Reichhaltigkeit und Aufwendigkeit<br />
unbed<strong>in</strong>gte Erwähnung verdienende- Studie von Ursula Lehr, <strong>in</strong> der sie die außerordentlich<br />
hohe Anzahl von 660 qualitativen Interviews 218 (500 Frauen und 160 Männer) zur<br />
218 nach heutiger Bezeichnung<br />
96