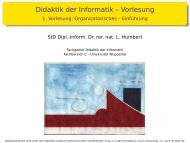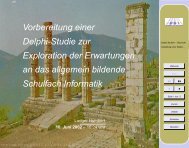Klassenbester in Deutsch oder Englisch? Nein danke – das passt ...
Klassenbester in Deutsch oder Englisch? Nein danke – das passt ...
Klassenbester in Deutsch oder Englisch? Nein danke – das passt ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Teilzeitbeschäftigung, weil eben zur aus Unternehmenssicht notwendigen flexibleren<br />
Arbeitsorganisation <strong>in</strong> bestimmten „weiblichen“ Berufsfeldern <strong>in</strong> der Regel<br />
Teilzeitarbeitskräfte beschäftigt werden. Denn: „In den verschiedenen Branchen und Berufen<br />
ist Teilzeitarbeit sehr unterschiedlich ausgeprägt: Am verbreitetsten ist diese Arbeitsform <strong>in</strong><br />
Dienstleistungsbranchen (Teilzeitarbeitsquote 19,4%) und im Handel (18,1%), also dort, wo<br />
häufig Frauen <strong>in</strong> relativ niedrig qualifizierten und entsprechend niedrig bezahlten<br />
Berufstätigkeiten als Verkäufer<strong>in</strong>nen, Sekretär<strong>in</strong>nen, Kellner<strong>in</strong>nen, Putzfrauen, Packer<strong>in</strong>nen,<br />
Hilfskräfte etc. arbeiten.“ (Willke 1998, S. 108f) Das verarbeitende Gewerbe als historisch<br />
wie aktuell männliches Terra<strong>in</strong> weist h<strong>in</strong>gegen nur die äußerst ger<strong>in</strong>ge Teilzeitrate von 4,4%<br />
auf (vgl. ebd.). Aber auch im akademischen Bereich ist für bestimmte Berufszweige e<strong>in</strong>e sich<br />
entlang der Geschlechtertrennl<strong>in</strong>ie bewegende Spaltung <strong>in</strong> Voll- und Teilzeitarbeit<br />
auszumachen. Für AbsolventInnen der stark weiblich dom<strong>in</strong>ierten Sozialwissenschaften ist<br />
die beachtliche Teilzeitquote von rund 50% zu verzeichnen (vgl. ebd., S. 106).<br />
Demgegenüber steht <strong>in</strong> dem als männlich geltenden Masch<strong>in</strong>enbau und im<br />
Elektro<strong>in</strong>genieurwesen e<strong>in</strong> Teilzeitanteil von gerade e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong>em Prozent, bzw. <strong>in</strong> den<br />
ebenfalls „männerspezifischen“ Diszipl<strong>in</strong>en Bau<strong>in</strong>genieurwesen und Architektur sowie <strong>in</strong> den<br />
Datenverarbeitungsberufen e<strong>in</strong>e Teilzeitrate von drei Prozent (vgl. IAB Kurzbericht 11/2002,<br />
S. 3). Nun wird Teilzeitarbeit e<strong>in</strong>erseits als prekäres Beschäftigungsverhältnis angesehen,<br />
weil sie üblicherweise -zum<strong>in</strong>dest bei der aktuellen Organisation von Erwerbsarbeit <strong>in</strong><br />
<strong>Deutsch</strong>land- e<strong>in</strong>e unzureichende eigenständige materielle Sicherung bietet und außerdem<br />
nicht für den Aufbau ausreichender Arbeitslosengeldansprüche ausreicht (vgl. Willke 1998, S.<br />
107), was gerade im Teilzeitsektor besonders relevant se<strong>in</strong> dürfte, da hier auf dem<br />
Arbeitsmarkt wesentlich mehr befristete Arbeitsverhältnisse angeboten werden als im<br />
Vollzeitsektor. So hatten <strong>in</strong> den dem Vollzeitsektor zugehörigen, bereits genannten<br />
„männertypischen“ Fachrichtungen Masch<strong>in</strong>enbau, Elektro- und Bau<strong>in</strong>genieurwesen,<br />
Architektur und <strong>in</strong> den Datenverarbeitungsberufen im Jahr 2000 nur sieben Prozent der<br />
Frauen und lediglich vier Prozent der Männer befristete Verträge, die übrigen verfügten über<br />
unbefristete Arbeitsvere<strong>in</strong>barungen (vgl. IAB Kurzbericht 11/2002, S. 2). Andererseits<br />
offeriert Teilzeitarbeit nicht bloß aktuell, sondern auch perspektivisch ger<strong>in</strong>ge soziale<br />
Sicherheit, <strong>in</strong>dem sie <strong>in</strong>folge der Kopplung der Alterssicherung an e<strong>in</strong>e Vollzeittätigkeit den<br />
Aufbau von Rentenansprüchen nur <strong>in</strong> unzureichendem Maße gestattet (vgl. Willke 1998, S.<br />
107). Weiterh<strong>in</strong> werden aus Teilzeitarbeitskräften wegen der bezüglich der zeitlichen<br />
Intensität 104 schlechteren Integration <strong>in</strong> den Arbeitsprozess üblicherweise ke<strong>in</strong>e<br />
Führungskräfte rekrutiert. In <strong>Deutsch</strong>land haben Frauen zwischen zwei und acht Prozent 105<br />
der Führungspositionen <strong>in</strong>ne (vgl. Engelbrech et al. 1998, S. 7). Für diese weibliche<br />
M<strong>in</strong>imalvertretung auf dem Gipfel der Berufspyramide dürfte also -neben der „gläsernen<br />
Decke“ (deren Begriff im Zusammenhang mit e<strong>in</strong>er 1997 veröffentlichten Studie des<br />
Internationalen Arbeitsamtes ILO geprägt wurde und die aus Stereotypen erwachsenden,<br />
Frauen zugedachten Aufstiegsbarrieren be<strong>in</strong>haltet, vgl. ebd., S. 9) und dem<br />
Geschlechtsrollenkonformitätszwang, welchen sich sozialisationsbed<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong> Teil der Frauen<br />
auch selbst auferlegt- gleichfalls e<strong>in</strong>e „geschlechtstypische“ Berufswahl von Mädchen<br />
verantwortlich zeichnen, <strong>in</strong> der sich ger<strong>in</strong>gere Qualifikation und schlechteres Involviertse<strong>in</strong> <strong>in</strong><br />
104 Wobei re<strong>in</strong>e Präsenz am Arbeitsplatz selbstverständlich nicht automatisch mit tatsächlicher Arbeitseffektivität<br />
gleichzusetzen ist. Kann doch e<strong>in</strong> leger und uneffektiv organisierter 12-Stunden-Arbeitstag unter Umständen<br />
ebensoviel „output“ br<strong>in</strong>gen wie e<strong>in</strong> straff und effektiv organisierter 8-Stunden-Arbeitstag. Darauf deutet auch<br />
e<strong>in</strong> aus e<strong>in</strong>er neueren Studie über Väter gewonnenes Forschungsergebnis h<strong>in</strong>, welches besagt, <strong>das</strong>s Vätern mit<br />
<strong>in</strong>tr<strong>in</strong>sischer Motivation für ihre Erwerbsarbeit die Vere<strong>in</strong>barkeit von Familie und Beruf besonders gut gel<strong>in</strong>gt.<br />
(vgl. Fthenakis, Wassilos E./ M<strong>in</strong>sel, Beate: Die Rolle des Vaters <strong>in</strong> der Familie. Zusammenfassung des<br />
Forschungsberichts. 1. Auflage, Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Berl<strong>in</strong> 2001, S.<br />
13f)<br />
105<br />
Dabei erklärt sich die Differenz von sechs Prozent aus der E<strong>in</strong>beziehung von unterschiedlichen<br />
Hierarchieebenen bei der Def<strong>in</strong>ition des Begriffes „Führungskraft“.<br />
51